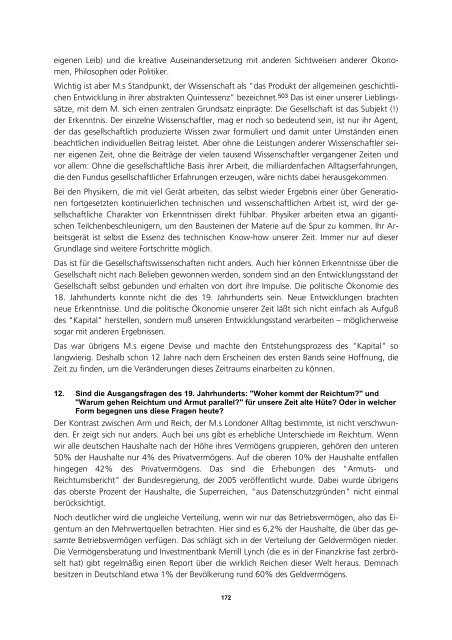Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eigenen Leib) und die kreative Ause<strong>in</strong>andersetzung mit anderen Sichtweisen anderer Ökonomen,<br />
Philosophen oder Politiker.<br />
Wichtig ist aber M.s Standpunkt, der Wissenschaft als "das Produkt der allgeme<strong>in</strong>en geschichtlichen<br />
Entwicklung <strong>in</strong> ihrer abstrakten Qu<strong>in</strong>tessenz" bezeichnet. 503 <strong>Das</strong> ist e<strong>in</strong>er unserer Liebl<strong>in</strong>gssätze,<br />
mit dem M. sich e<strong>in</strong>en zentralen Grundsatz e<strong>in</strong>prägte: Die Gesellschaft ist das Subjekt (!)<br />
der Erkenntnis. Der e<strong>in</strong>zelne Wissenschaftler, mag er noch so bedeutend se<strong>in</strong>, ist nur ihr Agent,<br />
der das gesellschaftlich produzierte Wissen zwar formuliert und damit unter Umständen e<strong>in</strong>en<br />
beachtlichen <strong>in</strong>dividuellen Beitrag leistet. Aber ohne die Leistungen anderer Wissenschaftler se<strong>in</strong>er<br />
eigenen Zeit, ohne die Beiträge der vielen tausend Wissenschaftler vergangener Zeiten und<br />
vor allem: Ohne die gesellschaftliche Basis ihrer Arbeit, die milliardenfachen Alltagserfahrungen,<br />
die den Fundus gesellschaftlicher Erfahrungen erzeugen, wäre nichts dabei herausgekommen.<br />
Bei den Physikern, die mit viel Gerät arbeiten, das selbst wieder Ergebnis e<strong>in</strong>er über Generationen<br />
fortgesetzten kont<strong>in</strong>uierlichen technischen und wissenschaftlichen Arbeit ist, wird der gesellschaftliche<br />
Charakter <strong>von</strong> Erkenntnissen direkt fühlbar. Physiker arbeiten etwa an gigantischen<br />
<strong>Teil</strong>chenbeschleunigern, um den Bauste<strong>in</strong>en der Materie auf die Spur zu kommen. Ihr Arbeitsgerät<br />
ist selbst die Essenz des technischen Know-how unserer Zeit. Immer nur auf dieser<br />
Grundlage s<strong>in</strong>d weitere Fortschritte möglich.<br />
<strong>Das</strong> ist für die Gesellschaftswissenschaften nicht anders. Auch hier können Erkenntnisse über die<br />
Gesellschaft nicht nach Belieben gewonnen werden, sondern s<strong>in</strong>d an den Entwicklungsstand der<br />
Gesellschaft selbst gebunden und erhalten <strong>von</strong> dort ihre Impulse. Die politische Ökonomie des<br />
18. Jahrhunderts konnte nicht die des 19. Jahrhunderts se<strong>in</strong>. Neue Entwicklungen brachten<br />
neue Erkenntnisse. Und die politische Ökonomie unserer Zeit läßt sich nicht e<strong>in</strong>fach als Aufguß<br />
des "Kapital" herstellen, sondern muß unseren Entwicklungsstand verarbeiten – möglicherweise<br />
sogar mit anderen Ergebnissen.<br />
<strong>Das</strong> war übrigens M.s eigene Devise und machte den Entstehungsprozess des "Kapital" so<br />
langwierig. Deshalb schon 12 Jahre nach dem Ersche<strong>in</strong>en des ersten Bands se<strong>in</strong>e Hoffnung, die<br />
Zeit zu f<strong>in</strong>den, um die Veränderungen dieses Zeitraums e<strong>in</strong>arbeiten zu können.<br />
12. S<strong>in</strong>d die Ausgangsfragen des 19. Jahrhunderts: "Woher kommt der Reichtum?" und<br />
"Warum gehen Reichtum und Armut parallel?" für unsere Zeit alte Hüte? Oder <strong>in</strong> welcher<br />
Form begegnen uns diese Fragen heute?<br />
Der Kontrast zwischen Arm und Reich, der M.s Londoner Alltag bestimmte, ist nicht verschwunden.<br />
Er zeigt sich nur anders. Auch bei uns gibt es erhebliche Unterschiede im Reichtum. Wenn<br />
wir alle deutschen Haushalte nach der Höhe ihres Vermögens gruppieren, gehören den unteren<br />
50% der Haushalte nur 4% des Privatvermögens. Auf die oberen 10% der Haushalte entfallen<br />
h<strong>in</strong>gegen 42% des Privatvermögens. <strong>Das</strong> s<strong>in</strong>d die Erhebungen des "Armuts- und<br />
Reichtumsbericht" der Bundesregierung, der 2005 veröffentlicht wurde. Dabei wurde übrigens<br />
das oberste Prozent der Haushalte, die Superreichen, "aus Datenschutzgründen" nicht e<strong>in</strong>mal<br />
berücksichtigt.<br />
Noch deutlicher wird die ungleiche Verteilung, wenn wir nur das Betriebsvermögen, also das Eigentum<br />
an den Mehrwertquellen betrachten. Hier s<strong>in</strong>d es 6,2% der Haushalte, die über das gesamte<br />
Betriebsvermögen verfügen. <strong>Das</strong> schlägt sich <strong>in</strong> der Verteilung der Geldvermögen nieder.<br />
Die Vermögensberatung und Investmentbank Merrill Lynch (die es <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzkrise fast zerbröselt<br />
hat) gibt regelmäßig e<strong>in</strong>en Report über die wirklich Reichen dieser Welt heraus. Demnach<br />
besitzen <strong>in</strong> Deutschland etwa 1% der Bevölkerung rund 60% des Geldvermögens.<br />
172