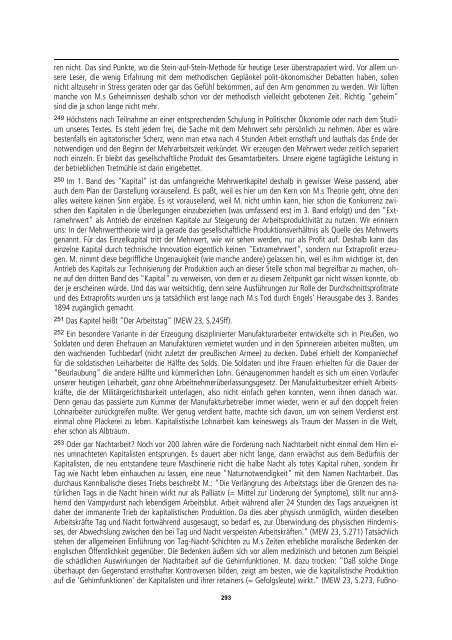Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
en nicht. <strong>Das</strong> s<strong>in</strong>d Punkte, wo die Ste<strong>in</strong>-auf-Ste<strong>in</strong>-Methode für heutige Leser überstrapaziert wird. Vor allem unsere<br />
Leser, die wenig Erfahrung mit dem methodischen Geplänkel polit-ökonomischer Debatten haben, sollen<br />
nicht allzusehr <strong>in</strong> Stress geraten oder gar das Gefühl bekommen, auf den Arm genommen zu werden. Wir lüften<br />
manche <strong>von</strong> M.s Geheimnissen deshalb schon vor der methodisch vielleicht gebotenen Zeit. Richtig "geheim"<br />
s<strong>in</strong>d die ja schon lange nicht mehr.<br />
249 Höchstens nach <strong>Teil</strong>nahme an e<strong>in</strong>er entsprechenden Schulung <strong>in</strong> Politischer Ökonomie oder nach dem Studium<br />
unseres Textes. Es steht jedem frei, die Sache mit dem Mehrwert sehr persönlich zu nehmen. Aber es wäre<br />
bestenfalls e<strong>in</strong> agitatorischer Scherz, wenn man etwa nach 4 Stunden Arbeit ernsthaft und lauthals das Ende der<br />
notwendigen und den Beg<strong>in</strong>n der Mehrarbeitszeit verkündet. Wir erzeugen den Mehrwert weder zeitlich separiert<br />
noch e<strong>in</strong>zeln. Er bleibt das gesellschaftliche Produkt des Gesamtarbeiters. Unsere eigene tagtägliche Leistung <strong>in</strong><br />
der betrieblichen Tretmühle ist dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>gebettet.<br />
250 Im <strong>1.</strong> Band des "Kapital" ist das umfangreiche Mehrwertkapitel deshalb <strong>in</strong> gewisser Weise passend, aber<br />
auch dem Plan der Darstellung vorauseilend. Es paßt, weil es hier um den Kern <strong>von</strong> M.s Theorie geht, ohne den<br />
alles weitere ke<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n ergäbe. Es ist vorauseilend, weil M. nicht umh<strong>in</strong> kann, hier schon die Konkurrenz zwischen<br />
den Kapitalen <strong>in</strong> die Überlegungen e<strong>in</strong>zubeziehen (was umfassend erst im 3. Band erfolgt) und den "Extramehrwert"<br />
als Antrieb der e<strong>in</strong>zelnen Kapitale zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zu nutzen. Wir er<strong>in</strong>nern<br />
uns: In der Mehrwerttheorie wird ja gerade das gesellschaftliche Produktionsverhältnis als Quelle des Mehrwerts<br />
genannt. Für das E<strong>in</strong>zelkapital tritt der Mehrwert, wie wir sehen werden, nur als Profit auf. Deshalb kann das<br />
e<strong>in</strong>zelne Kapital durch technische Innovation eigentlich ke<strong>in</strong>en "Extramehrwert", sondern nur Extraprofit erzeugen.<br />
M. nimmt diese begriffliche Ungenauigkeit (wie manche andere) gelassen h<strong>in</strong>, weil es ihm wichtiger ist, den<br />
Antrieb des Kapitals zur Technisierung der Produktion auch an dieser Stelle schon mal begreifbar zu machen, ohne<br />
auf den dritten Band des "Kapital" zu verweisen, <strong>von</strong> dem er zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen konnte, ob<br />
der je ersche<strong>in</strong>en würde. Und das war weitsichtig, denn se<strong>in</strong>e Ausführungen zur Rolle der Durchschnittsprofitrate<br />
und des Extraprofits wurden uns ja tatsächlich erst lange nach M.s Tod durch Engels' Herausgabe des 3. Bandes<br />
1894 zugänglich gemacht.<br />
251 <strong>Das</strong> Kapitel heißt "Der Arbeitstag" (MEW 23, S.245ff).<br />
252 E<strong>in</strong> besondere Variante <strong>in</strong> der Erzeugung diszipl<strong>in</strong>ierter Manufakturarbeiter entwickelte sich <strong>in</strong> Preußen, wo<br />
Soldaten und deren Ehefrauen an Manufakturen vermietet wurden und <strong>in</strong> den Sp<strong>in</strong>nereien arbeiten mußten, um<br />
den wachsenden Tuchbedarf (nicht zuletzt der preußischen Armee) zu decken. Dabei erhielt der Kompaniechef<br />
für die soldatischen Leiharbeiter die Hälfte des Solds. Die Soldaten und ihre Frauen erhielten für die Dauer der<br />
"Beurlaubung" die andere Hälfte und kümmerlichen Lohn. Genaugenommen handelt es sich um e<strong>in</strong>en Vorläufer<br />
unserer heutigen Leiharbeit, ganz ohne Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Der Manufakturbesitzer erhielt Arbeitskräfte,<br />
die der Militärgerichtsbarkeit unterlagen, also nicht e<strong>in</strong>fach gehen konnten, wenn ihnen danach war.<br />
Denn genau das passierte zum Kummer der Manufakturbetreiber immer wieder, wenn er auf den doppelt freien<br />
Lohnarbeiter zurückgreifen mußte. Wer genug verdient hatte, machte sich da<strong>von</strong>, um <strong>von</strong> se<strong>in</strong>em Verdienst erst<br />
e<strong>in</strong>mal ohne Plackerei zu leben. Kapitalistische Lohnarbeit kam ke<strong>in</strong>eswegs als Traum der Massen <strong>in</strong> die Welt,<br />
eher schon als Albtraum.<br />
253 Oder gar Nachtarbeit? Noch vor 200 Jahren wäre die Forderung nach Nachtarbeit nicht e<strong>in</strong>mal dem Hirn e<strong>in</strong>es<br />
umnachteten Kapitalisten entsprungen. Es dauert aber nicht lange, dann erwächst aus dem Bedürfnis der<br />
Kapitalisten, die neu entstandene teure Masch<strong>in</strong>erie nicht die halbe Nacht als totes Kapital ruhen, sondern ihr<br />
Tag wie Nacht leben e<strong>in</strong>hauchen zu lassen, e<strong>in</strong>e neue "Naturnotwendigkeit" mit dem Namen Nachtarbeit. <strong>Das</strong><br />
durchaus Kannibalische dieses Triebs beschreibt M.: "Die Verlängrung des Arbeitstags über die Grenzen des natürlichen<br />
Tags <strong>in</strong> die Nacht h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> wirkt nur als Palliativ (= Mittel zur L<strong>in</strong>derung der Symptome), stillt nur annähernd<br />
den Vampyrdurst nach lebendigem Arbeitsblut. Arbeit während aller 24 Stunden des Tags anzueignen ist<br />
daher der immanente Trieb der kapitalistischen Produktion. Da dies aber physisch unmöglich, würden dieselben<br />
Arbeitskräfte Tag und Nacht fortwährend ausgesaugt, so bedarf es, zur Überw<strong>in</strong>dung des physischen H<strong>in</strong>dernisses,<br />
der Abwechslung zwischen den bei Tag und Nacht verspeisten Arbeitskräften." (MEW 23, S.271) Tatsächlich<br />
stehen der allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>führung <strong>von</strong> Tag-Nacht-Schichten zu M.s Zeiten erhebliche moralische Bedenken der<br />
englischen Öffentlichkeit gegenüber. Die Bedenken äußern sich vor allem mediz<strong>in</strong>isch und betonen zum Beispiel<br />
die schädlichen Auswirkungen der Nachtarbeit auf die Gehirnfunktionen. M. dazu trocken: "Daß solche D<strong>in</strong>ge<br />
überhaupt den Gegenstand ernsthafter Kontroversen bilden, zeigt am besten, wie die kapitalistische Produktion<br />
auf die 'Gehirnfunktionen' der Kapitalisten und ihrer reta<strong>in</strong>ers (= Gefolgsleute) wirkt." (MEW 23, S.273, Fußno-<br />
293