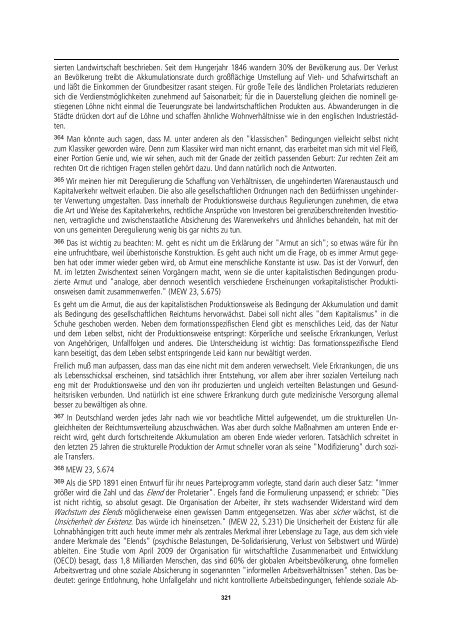Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Spurensuche Teil 1. Eine Studienreise in "Das Kapital" von Karl Marx
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sierten Landwirtschaft beschrieben. Seit dem Hungerjahr 1846 wandern 30% der Bevölkerung aus. Der Verlust<br />
an Bevölkerung treibt die Akkumulationsrate durch großflächige Umstellung auf Vieh- und Schafwirtschaft an<br />
und läßt die E<strong>in</strong>kommen der Grundbesitzer rasant steigen. Für große <strong>Teil</strong>e des ländlichen Proletariats reduzieren<br />
sich die Verdienstmöglichkeiten zunehmend auf Saisonarbeit; für die <strong>in</strong> Dauerstellung gleichen die nom<strong>in</strong>ell gestiegenen<br />
Löhne nicht e<strong>in</strong>mal die Teuerungsrate bei landwirtschaftlichen Produkten aus. Abwanderungen <strong>in</strong> die<br />
Städte drücken dort auf die Löhne und schaffen ähnliche Wohnverhältnisse wie <strong>in</strong> den englischen Industriestädten.<br />
364 Man könnte auch sagen, dass M. unter anderen als den "klassischen" Bed<strong>in</strong>gungen vielleicht selbst nicht<br />
zum Klassiker geworden wäre. Denn zum Klassiker wird man nicht ernannt, das erarbeitet man sich mit viel Fleiß,<br />
e<strong>in</strong>er Portion Genie und, wie wir sehen, auch mit der Gnade der zeitlich passenden Geburt: Zur rechten Zeit am<br />
rechten Ort die richtigen Fragen stellen gehört dazu. Und dann natürlich noch die Antworten.<br />
365 Wir me<strong>in</strong>en hier mit Deregulierung die Schaffung <strong>von</strong> Verhältnissen, die ungeh<strong>in</strong>derten Warenaustausch und<br />
Kapitalverkehr weltweit erlauben. Die also alle gesellschaftlichen Ordnungen nach den Bedürfnissen ungeh<strong>in</strong>derter<br />
Verwertung umgestalten. <strong>Das</strong>s <strong>in</strong>nerhalb der Produktionsweise durchaus Regulierungen zunehmen, die etwa<br />
die Art und Weise des Kapitalverkehrs, rechtliche Ansprüche <strong>von</strong> Investoren bei grenzüberschreitenden Investitionen,<br />
vertragliche und zwischenstaatliche Absicherung des Warenverkehrs und ähnliches behandeln, hat mit der<br />
<strong>von</strong> uns geme<strong>in</strong>ten Deregulierung wenig bis gar nichts zu tun.<br />
366 <strong>Das</strong> ist wichtig zu beachten: M. geht es nicht um die Erklärung der "Armut an sich"; so etwas wäre für ihn<br />
e<strong>in</strong>e unfruchtbare, weil überhistorische Konstruktion. Es geht auch nicht um die Frage, ob es immer Armut gegeben<br />
hat oder immer wieder geben wird, ob Armut e<strong>in</strong>e menschliche Konstante ist usw. <strong>Das</strong> ist der Vorwurf, den<br />
M. im letzten Zwischentext se<strong>in</strong>en Vorgängern macht, wenn sie die unter kapitalistischen Bed<strong>in</strong>gungen produzierte<br />
Armut und "analoge, aber dennoch wesentlich verschiedene Ersche<strong>in</strong>ungen vorkapitalistischer Produktionsweisen<br />
damit zusammenwerfen." (MEW 23, S.675)<br />
Es geht um die Armut, die aus der kapitalistischen Produktionsweise als Bed<strong>in</strong>gung der Akkumulation und damit<br />
als Bed<strong>in</strong>gung des gesellschaftlichen Reichtums hervorwächst. Dabei soll nicht alles "dem Kapitalismus" <strong>in</strong> die<br />
Schuhe geschoben werden. Neben dem formationsspezifischen Elend gibt es menschliches Leid, das der Natur<br />
und dem Leben selbst, nicht der Produktionsweise entspr<strong>in</strong>gt: Körperliche und seelische Erkrankungen, Verlust<br />
<strong>von</strong> Angehörigen, Unfallfolgen und anderes. Die Unterscheidung ist wichtig: <strong>Das</strong> formationsspezifische Elend<br />
kann beseitigt, das dem Leben selbst entspr<strong>in</strong>gende Leid kann nur bewältigt werden.<br />
Freilich muß man aufpassen, dass man das e<strong>in</strong>e nicht mit dem anderen verwechselt. Viele Erkrankungen, die uns<br />
als Lebensschicksal ersche<strong>in</strong>en, s<strong>in</strong>d tatsächlich ihrer Entstehung, vor allem aber ihrer sozialen Verteilung nach<br />
eng mit der Produktionsweise und den <strong>von</strong> ihr produzierten und ungleich verteilten Belastungen und Gesundheitsrisiken<br />
verbunden. Und natürlich ist e<strong>in</strong>e schwere Erkrankung durch gute mediz<strong>in</strong>ische Versorgung allemal<br />
besser zu bewältigen als ohne.<br />
367 In Deutschland werden jedes Jahr nach wie vor beachtliche Mittel aufgewendet, um die strukturellen Ungleichheiten<br />
der Reichtumsverteilung abzuschwächen. Was aber durch solche Maßnahmen am unteren Ende erreicht<br />
wird, geht durch fortschreitende Akkumulation am oberen Ende wieder verloren. Tatsächlich schreitet <strong>in</strong><br />
den letzten 25 Jahren die strukturelle Produktion der Armut schneller voran als se<strong>in</strong>e "Modifizierung" durch soziale<br />
Transfers.<br />
368 MEW 23, S.674<br />
369 Als die SPD 1891 e<strong>in</strong>en Entwurf für ihr neues Parteiprogramm vorlegte, stand dar<strong>in</strong> auch dieser Satz: "Immer<br />
größer wird die Zahl und das Elend der Proletarier". Engels fand die Formulierung unpassend; er schrieb: "Dies<br />
ist nicht richtig, so absolut gesagt. Die Organisation der Arbeiter, ihr stets wachsender Widerstand wird dem<br />
Wachstum des Elends möglicherweise e<strong>in</strong>en gewissen Damm entgegensetzen. Was aber sicher wächst, ist die<br />
Unsicherheit der Existenz. <strong>Das</strong> würde ich h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>setzen." (MEW 22, S.231) Die Unsicherheit der Existenz für alle<br />
Lohnabhängigen tritt auch heute immer mehr als zentrales Merkmal ihrer Lebenslage zu Tage, aus dem sich viele<br />
andere Merkmale des "Elends" (psychische Belastungen, De-Solidarisierung, Verlust <strong>von</strong> Selbstwert und Würde)<br />
ableiten. <strong>E<strong>in</strong>e</strong> Studie vom April 2009 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
(OECD) besagt, dass 1,8 Milliarden Menschen, das s<strong>in</strong>d 60% der globalen Arbeitsbevölkerung, ohne formellen<br />
Arbeitsvertrag und ohne soziale Absicherung <strong>in</strong> sogenannten "<strong>in</strong>formellen Arbeitsverhältnissen" stehen. <strong>Das</strong> bedeutet:<br />
ger<strong>in</strong>ge Entlohnung, hohe Unfallgefahr und nicht kontrollierte Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen, fehlende soziale Ab-<br />
321