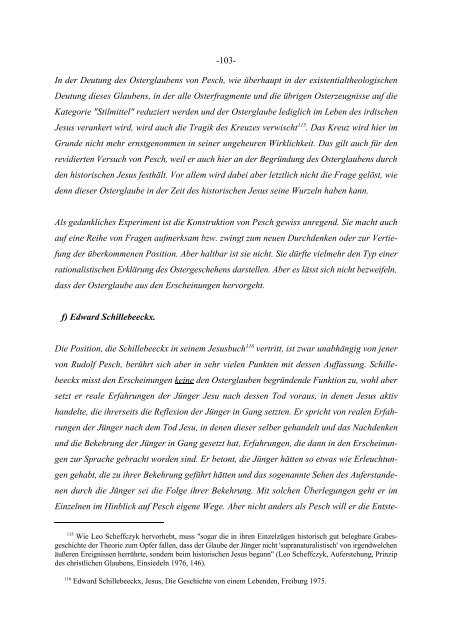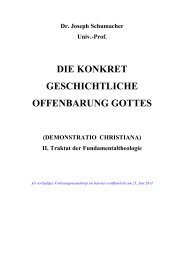- Seite 1 und 2:
Dr. Joseph Schumacher Univ.-Prof. D
- Seite 3 und 4:
c) Corpus spiritale, corpus caelest
- Seite 5 und 6:
7. Der Petrusprimat. a.) Die Sonder
- Seite 7 und 8:
-6- h.) Kennenlernen der eigenen Po
- Seite 9 und 10:
-8- Argumente zusammentragen. Wir f
- Seite 11 und 12:
-10- hängt mit “nasci” zusamme
- Seite 13 und 14:
-12- Darstellung des göttlichen We
- Seite 15 und 16:
-14- Die theologische Erkenntnisleh
- Seite 17 und 18:
-16- nicht kirchlich katholische Me
- Seite 19 und 20:
-18- türlich-übernatürliche Real
- Seite 21 und 22:
-20- auf die Frei-heit der Zustimmu
- Seite 23 und 24:
-22- Die Evangelisten berichten etw
- Seite 25 und 26:
-24- Zur Unterstreichung der fundam
- Seite 27 und 28:
-26- erleichtert. Dabei ergriffen i
- Seite 29 und 30:
4. Grund und Gegenstand des Glauben
- Seite 31 und 32:
-30- Sie hätten also bewussten Bet
- Seite 33 und 34:
-32- Dagegen spricht die klare Auss
- Seite 35 und 36:
-34- Sofern die Eschatologie des Al
- Seite 37 und 38:
-36- Dan 12,2, begegnet uns zum ers
- Seite 39 und 40:
-38- auch die griechische Unsterbli
- Seite 41 und 42:
-40- zung für die eschatologische
- Seite 43 und 44:
-42- Hellenismus. Der Hellenismus i
- Seite 45 und 46:
31 Ebd. 32 Ebd., q. 54, a. 1, ad 2.
- Seite 47 und 48:
34 Ebd., q.55, a.1, corp. art. 35 E
- Seite 49 und 50:
-48- also an dem Auferstandenen, ob
- Seite 51 und 52:
40 Ebd., 254. -50- Um es noch einma
- Seite 53 und 54: -52- schauenden, fundamentaltheolog
- Seite 55 und 56: -54- beuge jedes Knie: der Himmlisc
- Seite 57 und 58: -56- Allgemein wird in den Glaubens
- Seite 59 und 60: -58- greiflich geworden, ist der Ä
- Seite 61 und 62: -60- 43 bis unmittelbar an die in i
- Seite 63 und 64: -62- Im 1. Koritntherbrief, 1 Kor 9
- Seite 65 und 66: 45 Vgl. auch Adolf Kolping, Vorlesu
- Seite 67 und 68: Lk 24,13-35: Emmausgeschichte, -66-
- Seite 69 und 70: -68- 47 apostolischen Kerygmas übe
- Seite 71 und 72: -70- wie es sich aus den Traditione
- Seite 73 und 74: -72- gehofft, dass er Israel erlös
- Seite 75 und 76: -74- communis" der Exegeten entspri
- Seite 77 und 78: -76- dass der Ton hier ursprünglic
- Seite 79 und 80: -78- Apostelgeschichte. Selbst in d
- Seite 81 und 82: -80- Auferstandenen. Das geschieht
- Seite 83 und 84: 79 Ebd., 44. -82- Kreuz Christi als
- Seite 85 und 86: -84- Braun meint, verbindlich sei f
- Seite 87 und 88: -86- der Interpretamente, weil sich
- Seite 89 und 90: -88- Es geht letztlich um die zwei
- Seite 91 und 92: -90- seiner Christologie und Soteri
- Seite 93 und 94: -92- Osterglaube, dann kamen die Er
- Seite 95 und 96: -94- Weg gewiesen, auf dem sie auch
- Seite 97 und 98: -96- Nach Pesch sprechen die Ersche
- Seite 99 und 100: -98- angesichts seines Leidens und
- Seite 101 und 102: 102 Ebd. -100- 102 che(n) Vielfalt"
- Seite 103: 110. 109 -102- 109 psychologische W
- Seite 107 und 108: -106- wahr seien, sei jedes Interes
- Seite 109 und 110: -108- er von dem Auferstandenen wie
- Seite 111 und 112: -110- b) Der Neuansatz im Verständ
- Seite 113 und 114: -112- zur vollen Gewissheit. Der Os
- Seite 115 und 116: -114- allen Evangelien die Aussagen
- Seite 117 und 118: -116- Anlass der Aussage erklären.
- Seite 119 und 120: -118- Paulus fasst das In-Erscheinu
- Seite 121 und 122: -120- für die Adressaten seiner Ve
- Seite 123 und 124: 140 Lumen gentium, Art. 8. -122- II
- Seite 125 und 126: -124- Die nachösterliche Jüngersc
- Seite 127 und 128: -126- “Teilkirche”. Daraus folg
- Seite 129 und 130: -128- ständigen Überzeugung der K
- Seite 131 und 132: 146 Lumen gentium, Art. 18. 147 Ebd
- Seite 133 und 134: -132- Berufung der Zwölf, seine be
- Seite 135 und 136: -134- Harnack († 1930) hat man im
- Seite 137 und 138: -136- den An-spruch Jesu sowie den
- Seite 139 und 140: 153 bereitet” hat . -138- Jesus h
- Seite 141 und 142: -140- Im Blick auf dieses Faktum ha
- Seite 143 und 144: -142- Jesus knüpft in seiner “β
- Seite 145 und 146: -144- von der Naherwartung her begr
- Seite 147 und 148: -146- ihrem Gehalt: Jesus erklärt,
- Seite 149 und 150: -148- Ähnlich erklärt sich auch d
- Seite 151 und 152: Gegebenheit ist. -150- Daraus folgt
- Seite 153 und 154: 165 Alfred Loisy, Autour d'un petit
- Seite 155 und 156:
-154- Jetztgestalt des Gottesherrsc
- Seite 157 und 158:
-156- und welche Botschaft er verk
- Seite 159 und 160:
-158- gelagert ist. Ohne die Wahrha
- Seite 161 und 162:
-160- 172 Prüfung und Scheidung im
- Seite 163 und 164:
-162- Hinweis darauf, dass der neue
- Seite 165 und 166:
177 Adolf Kolping, Vorlesungsmanusk
- Seite 167 und 168:
-166- Kirche. Das erklärt die Tats
- Seite 169 und 170:
-168- scheidung für die Nachfolge
- Seite 171 und 172:
-170- allein den Simon an: “Fürc
- Seite 173 und 174:
ζ.) Joh 21,2-13. 178 Adolf Kolping
- Seite 175 und 176:
-174- “Bekenntnis - Forderung und
- Seite 177 und 178:
179 Adolf Kolping, Vorlesungsmanusk
- Seite 179 und 180:
-178- Ein weiteres Moment, das hier
- Seite 181 und 182:
Stämme Israels beteiligt werden. -
- Seite 183 und 184:
-182- Wie die zwölf Patriarchen, d
- Seite 185 und 186:
-184- Zu dieser synoptischen vorös
- Seite 187 und 188:
-186- Zu der hier an diesen Stellen
- Seite 189 und 190:
-188- und Apg 1,8). Die nachösterl
- Seite 191 und 192:
-190- Es ist sehr wahrscheinlich, d
- Seite 193 und 194:
-192- steht: “... die er auch Apo
- Seite 195 und 196:
185 volk . -194- Diese Grundlinien
- Seite 197 und 198:
c.) Das lukanische Apostelbild. -19
- Seite 199 und 200:
-198- der Wüste. Dann reist er, in
- Seite 201 und 202:
-200- 10,40 - ich nannte Ihnen dies
- Seite 203 und 204:
-202- der göttliche Offenbarung ve
- Seite 205 und 206:
der Sendung Jesu. -204- Der primär
- Seite 207 und 208:
-206- 196 Bezeichnung der Zwölf al
- Seite 209 und 210:
-208- und der Priester. Der Apostel
- Seite 211 und 212:
-210- anders, als das bereits im Al
- Seite 213 und 214:
-212- berufene, und zwar mit seinem
- Seite 215 und 216:
-214- Gemäß den Evangelien geht d
- Seite 217 und 218:
-216- Sehen wir uns die einzelnen S
- Seite 219 und 220:
-218- wo auch die Protophanie vor P
- Seite 221 und 222:
-220- 23). Dann folgen die beiden S
- Seite 223 und 224:
-222- man nicht die Sprache und den
- Seite 225 und 226:
-224- ssung ist. Wäre die Matthäu
- Seite 227 und 228:
-226- In Erwiderung auf die Argumen
- Seite 229 und 230:
-228- Bei der Wahl des Bildes vom F
- Seite 231 und 232:
-230- kenntnis oder der Glaube geh
- Seite 233 und 234:
209 Adolf Kolping, Vorlesungsmanusk
- Seite 235 und 236:
-234- die Verwirklichung der aposto
- Seite 237 und 238:
218 Johannes Calvin, Institutiones
- Seite 239 und 240:
-238- der Urgemeinde bzw. der Offen
- Seite 241 und 242:
229 Augustinus, Contra Faust., 22,1
- Seite 243 und 244:
-242- neronische Verfolgung schlie
- Seite 245 und 246:
-244- beiden Apostel früher einmal
- Seite 247 und 248:
239 Irenäus von Lyon, Adversus hae
- Seite 249 und 250:
-248- Das Letzte, was sich historis
- Seite 251 und 252:
-250- Griechische übertragen und s
- Seite 253 und 254:
-252- Was die zerstreute Jüngersch
- Seite 255 und 256:
-254- Zentrum der Kirche war Rom ge
- Seite 257 und 258:
249 Ebd., 115. 250 Ebd., 115 f. -25
- Seite 259 und 260:
-258- Verfolger zu einem glühenden
- Seite 261 und 262:
251 Ebd., 116-125. -260- Dieses Mal
- Seite 263 und 264:
253 Vgl. auch DS 3450. -262- 253 un
- Seite 265 und 266:
-264- Alle Dienste und Ämter, ob s
- Seite 267 und 268:
-266- antwortlichen der Gesamtgemei
- Seite 269 und 270:
5,12). -268- Es gab hier demnach Ge
- Seite 271 und 272:
-270- Was die paulinischen Gemeinde
- Seite 273 und 274:
-272- Ephesus annehmen, von denen P
- Seite 275 und 276:
-274- damit die Gemeindeverfassung
- Seite 277 und 278:
-276- Vorstehers. Er soll Sorge tra
- Seite 279 und 280:
-278- Die Funktionen der Ältesten
- Seite 281 und 282:
-280- Presbyter ihre Stellung zwisc
- Seite 283 und 284:
-282- ten eine völlig andere Struk
- Seite 285 und 286:
-284- 1581), wobei wiederum für ih
- Seite 287 und 288:
-286- Demnach ist also die Symbolik
- Seite 289 und 290:
-288- betreffende Gabe den Charakte
- Seite 291 und 292:
-290- das Amt in ihr, und zwar in e
- Seite 293 und 294:
-292- jeher als unabänderlich vers
- Seite 295 und 296:
288 Ebd., 150-152. -294- primär al
- Seite 297 und 298:
-296- Auf jeden Fall zeigt sich deu
- Seite 299 und 300:
-298- ze gibt es keinen Widerspruch
- Seite 301 und 302:
-300- In der apostolischen Kirche w
- Seite 303 und 304:
303 Ebd., 69 f. 304 Ebd., 70. 305 C
- Seite 305 und 306:
-304- Schon in alter Zeit konnte de
- Seite 307 und 308:
-306- nicht überall sein konnte, n
- Seite 309 und 310:
326 Ebd., Art. 28. -308- priesterli
- Seite 311 und 312:
331 Ebd., 108 f. 332 Ebd., 103. 333
- Seite 313 und 314:
342 Vgl. ebd. 101 f. 343 Ebd., 75 f
- Seite 315 und 316:
346 Ebd., 96 f. 347 Ebd., 97 f. -31
- Seite 317 und 318:
352 -316- beliebigen Gemeinschaft t
- Seite 319 und 320:
-318- Hier nun verschiebt sich das
- Seite 321 und 322:
-320- Apostolates und der Caritas i
- Seite 323 und 324:
-322- die Kirche nicht statisch ein
- Seite 325 und 326:
-324- 361 von einer Amtsübertragun
- Seite 327 und 328:
364 Vgl. ebd., 44 f. 365 Vgl. ebd.,
- Seite 329 und 330:
368 Cyprian von Karthago, Epistula
- Seite 331 und 332:
-330- te genießen und in der kirch
- Seite 333 und 334:
-332- Aufklärung angestoßen wurde
- Seite 335 und 336:
-334- Transzendenz an der Kategorie
- Seite 337 und 338:
-336- in der Kirche erfließt demge
- Seite 339 und 340:
-338- nisch verwurzelt im Apostelam
- Seite 341 und 342:
380 Einheit dienen" . 380 Ebd., 82.
- Seite 343 und 344:
-342- Kommission nicht doch zu weit
- Seite 345 und 346:
-344- Auch rein gefühlsmäßig hat
- Seite 347 und 348:
-346- Schwierigkeiten zu überwinde
- Seite 349 und 350:
-348- christlichen Zeit. Hier wurde
- Seite 351 und 352:
393 ab omni-bus ..." . -350- Die vi
- Seite 353 und 354:
-352- numerische und als organische
- Seite 355 und 356:
-354- len Hirten und Lehrer in die
- Seite 357 und 358:
-356- erhält Nahrung und Stärkung
- Seite 359 und 360:
-358- "Ein jeder, der abweicht und
- Seite 361 und 362:
-360- Jesus hat eine hohe ethisch-r
- Seite 363 und 364:
408 Augustinus, Epistula 52, 1. -36
- Seite 365 und 366:
-364- 13,31.36.47; 24,14; 26,13). I
- Seite 367 und 368:
-366- Die Apostolizität bezieht si
- Seite 369 und 370:
-368- Der Gedanke der Sendung Jesu
- Seite 371 und 372:
-370- Die vier Kennzeichen, die aus
- Seite 373 und 374:
-372- Bereits Thomas von Aquin (+ 1
- Seite 375 und 376:
-374- und von Gemeinden in Libyen,
- Seite 377 und 378:
-376- einzelnen orthodoxen Kirchen
- Seite 379 und 380:
-378- Gewiss gibt es auch außerhal
- Seite 381 und 382:
-380- gegenüber einem Amt der Einh
- Seite 383 und 384:
-382- 441 gesunde Organismus scheid
- Seite 385 und 386:
-384- Diese genannten Kreise begrü
- Seite 387 und 388:
-386- Außerhalb seines eigenen Pat
- Seite 389 und 390:
-388- 446 benden Punkt aufzuweisen,
- Seite 391 und 392:
449 Hieronymus, Dialogus contra Luc
- Seite 393 und 394:
-392- Sie hat alle sozialen Gebilde
- Seite 395 und 396:
-394- orthodoxe Kirche hingegen hä
- Seite 397 und 398:
-396- chisch-hierarchische Leitung
- Seite 399 und 400:
-398- Ein wichtiger Punkt ist hier
- Seite 401 und 402:
-400- diesen Gemeinschaften bildete
- Seite 403 und 404:
-402- Kirche in fast allen Kommissi
- Seite 405 und 406:
463 Unitatis redintegratio, Art. 3.
- Seite 407 und 408:
467 Ebd., Art. 7. 468 Ebd., Art. 8
- Seite 409 und 410:
470 und Christi" . -408- Bestand de
- Seite 411 und 412:
-410- Grundlegend wichtig sind in d
- Seite 413 und 414:
f.) Positive Sicht der Andersgläub
- Seite 415 und 416:
-414- aus dem Ganzen heraus. Auch s
- Seite 417 und 418:
-416- dessen Ergebnis sich auch wie
- Seite 419 und 420:
-418- der ganzen uneingeschränkten
- Seite 421 und 422:
-420- Es ist aber wohl zu bedenken,
- Seite 423 und 424:
-422- in Christus die vollendete Ei
- Seite 425 und 426:
-424- der nichtchristlichen Religio
- Seite 427 und 428:
-426- BORNKAMM, Günther: Jesus von
- Seite 429 und 430:
kündigung beauftragt sind, Trier 1
- Seite 431 und 432:
3 bingen 1959. -430- HÖFER, Liselo
- Seite 433 und 434:
-432- KREMER, Johannes: Marginalien
- Seite 435 und 436:
-434- NACHKONZILIARE DOKUMENTE 9, T
- Seite 437 und 438:
-436- SCHIERSE, Franz Joseph.: Besp
- Seite 439 und 440:
-438- VALESKE, Ulrich: Hierarchia v
- Seite 441 und 442:
AUGUSTINUS, Aurelius: Sermo 130. CL
- Seite 443:
-442-