Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
c) Die Mindestgehaltsthese<br />
Letztli<strong>ch</strong> bleiben fünf Themenkreise, die jede Theorie politis<strong>ch</strong>er <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> behandeln<br />
muß, um staatli<strong>ch</strong>e Ordnung umfassend zu würdigen. Man kann insoweit<br />
von einem substantiellen Mindestgehalt <strong>der</strong> politis<strong>ch</strong>en Gere<strong>ch</strong>igkeitstheorien spre<strong>ch</strong>en<br />
(Mindestgehaltsthese). Diese Mindestgehaltsthese wird im letzten Teil dieser Arbeit<br />
als Ausgangspunkt für die Grundzüge einer Diskurstheorie <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
wie<strong>der</strong> aufgegriffen 366 . Der 'Mindestgehalt' läßt si<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>lagwortartig dur<strong>ch</strong> die Begriffe<br />
'Begründungsmodell', 'Institutionalisierung', 'Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te', 'Demokratie'<br />
und 'Güterverteilung' bezei<strong>ch</strong>nen 367 .<br />
Ein Begründungsmodell ist nötig, weil die Explikation von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> in unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>er<br />
Weise auf eine Konzeption <strong>der</strong> allgemeinen praktis<strong>ch</strong>en Vernunft gestützt<br />
werden kann. Die Institutionalisierung betrifft die Frage, warum es gere<strong>ch</strong>t ist,<br />
daß eine staatli<strong>ch</strong>e Zwangsordnung überhaupt besteht. Dabei geht es um die Verteidigung<br />
von Re<strong>ch</strong>tspfli<strong>ch</strong>ten gegenüber Konzepten des Anar<strong>ch</strong>ismus – ein Kernproblem<br />
<strong>der</strong> politis<strong>ch</strong>en Philosophie 368 . Für die Ma<strong>ch</strong>tkontrolle innerhalb einer staatli<strong>ch</strong>en<br />
Zwangsordnung ist sodann bedeutsam, ob und in wel<strong>ch</strong>em Umfang bestimmte<br />
Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te <strong>der</strong> Regelungskompetenz <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>ts- und Staatsordnung entzogen<br />
sein müssen. Mit <strong>der</strong> Thematisierung von Demokratie ist s<strong>ch</strong>lagwortartig die Frage<br />
gestellt, wel<strong>ch</strong>en Anteil die Betroffenen an <strong>der</strong> Ents<strong>ch</strong>eidung über staatli<strong>ch</strong>e Belange<br />
haben müssen. Und s<strong>ch</strong>ließli<strong>ch</strong> ist mit Güterverteilung die Frage <strong>der</strong> 'sozialen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>'<br />
aufgeworfen, also einerseits <strong>der</strong> Mindestausstattung mit Gütern, die in einer<br />
Sozialordnung für alle gewährleistet sein muß, und an<strong>der</strong>erseits <strong>der</strong> staatli<strong>ch</strong>en Befugnisse<br />
und Pfli<strong>ch</strong>ten, eine ausglei<strong>ch</strong>ende Umverteilung von Gütern zu bewirken.<br />
Bei <strong>der</strong> Beantwortung dieser fünf Fragen kann si<strong>ch</strong> eine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie<br />
ni<strong>ch</strong>t darauf bes<strong>ch</strong>ränken, einzelne staatli<strong>ch</strong>e Gemeinwesen zu untersu<strong>ch</strong>en. Denn<br />
366 Dazu unten S. 309 (Fünf Fragen politis<strong>ch</strong>er <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>).<br />
367 Ähnli<strong>ch</strong>keit zu diesem Fragenkatalog haben die drei Stufen <strong>der</strong> Philosophie des Politis<strong>ch</strong>en bei<br />
O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1987), S. 33 f. Au<strong>ch</strong> Höffe kann insoweit als Vertreter einer Mindestgehaltsthese<br />
angesehen werden. Au<strong>ch</strong> F. Bydlinski, <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als re<strong>ch</strong>tspraktis<strong>ch</strong>er Maßstab<br />
(1996), S. 149 ff. hebt die Fragen <strong>der</strong> Freiheit (hier: Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te, Demokratie) und sozialen<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (hier: Güterverteilung) als speziellere <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sprobleme außergewöhnli<strong>ch</strong>er<br />
Komplexität hervor.<br />
368 Vgl. V. Medina, Social Contract Theories (1990), S. 135 ff. sowie S. 111: »In short, social contract<br />
theorists are addressing at least two major questions: Whom should we obey? And why?« <strong>Theorien</strong><br />
<strong>der</strong> 'geordneten Anar<strong>ch</strong>ie' (z.B. Bu<strong>ch</strong>anan, dazu unten S. 177 – Ideal einer geordneten Anar<strong>ch</strong>ie)<br />
sind ni<strong>ch</strong>t dasselbe wie das reine anar<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>e Ideal einer völligen Herrs<strong>ch</strong>aftslosigkeit, die<br />
zur Absage an jede Staatli<strong>ch</strong>keit führen muß; vgl. dazu M.A. Bakunin, Staatli<strong>ch</strong>keit und Anar<strong>ch</strong>ie<br />
(1873), S. 278: »Wer Staat sagt, sagt notwendigerweise Unterdrückung und folgli<strong>ch</strong> Sklaverei; ein<br />
Staat ohne Sklaverei, offen o<strong>der</strong> vers<strong>ch</strong>leiert, ist undenkbar, deshalb sind wir Feinde des Staates.«;<br />
sowie ebd., S. 308: »Auf <strong>der</strong> pangermanis<strong>ch</strong>en Fahne steht ges<strong>ch</strong>rieben: Erhaltung und Stärkung des<br />
Staates um jeden Preis; auf <strong>der</strong> Fahne <strong>der</strong> sozialen Revolution, auf unserer Fahne, wird dagegen mit<br />
Bu<strong>ch</strong>staben aus Feuer und Blut ges<strong>ch</strong>rieben stehen: Zerstörung aller Staaten, Abs<strong>ch</strong>affung <strong>der</strong> bürgerli<strong>ch</strong>en<br />
Kultur, spontane Organisation von unten na<strong>ch</strong> oben mit Hilfe freier Assoziationen befreiter Arbeitermassen<br />
und <strong>der</strong> gesamten Mens<strong>ch</strong>heit und Gründung einer neuen mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Gesells<strong>ch</strong>aft.« (Hervorhebung<br />
bei Bakunin). Ähnli<strong>ch</strong> ents<strong>ch</strong>lossen P.J. Proudhon, Philosophie <strong>der</strong> Staatsökonomie<br />
(1846), Bd. 2, S. 213: »Das Eigenthum ist eine Einri<strong>ch</strong>tung <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>, und das Eigenthum<br />
ist <strong>der</strong> Diebstahl.« (Hervorhebung bei Proudhon).<br />
117


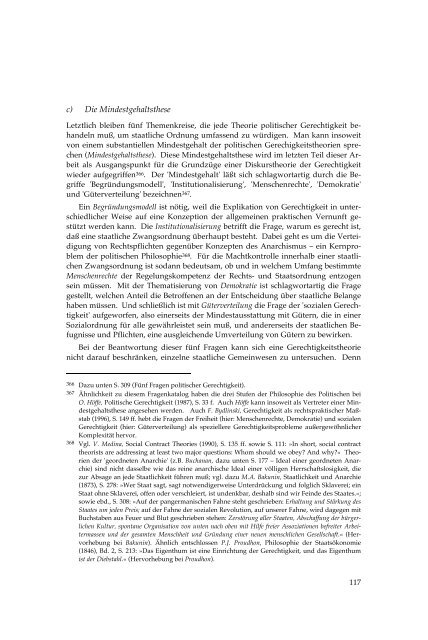



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









