Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auf <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> beantwortet, entwe<strong>der</strong> weil das Handeln überhaupt keiner Re<strong>ch</strong>tfertigung<br />
bedarf, o<strong>der</strong> weil eine inhaltli<strong>ch</strong>e Re<strong>ch</strong>tfertigung unmögli<strong>ch</strong> ist.<br />
Mit dem Gesagten ist klar, daß <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> nietzs<strong>ch</strong>eanis<strong>ch</strong>en Tradition keine<br />
materialen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien sein können, denn die inhaltli<strong>ch</strong>e Festlegung von<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> lehnen sie gerade ab. Es handelt si<strong>ch</strong> aber au<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t um prozedurale<br />
<strong>Theorien</strong> im Sinne von D 4 . Zwar bleibt den <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sskeptikern mangels inhaltli<strong>ch</strong>er<br />
Anknüpfungspunkte letztli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>ts an<strong>der</strong>es übrig, als auf bestimmte Verfahren<br />
zur Regelung <strong>der</strong> sozialen Ordnung zu setzen. Sie sind deshalb prozedural in<br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>serzeugung. Aber in <strong>der</strong> Einhaltung gedankli<strong>ch</strong>er Verfahren sehen<br />
sie keine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegründung 11 .<br />
Die <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> nietzs<strong>ch</strong>eanis<strong>ch</strong>en Grundposition erweisen si<strong>ch</strong> also bei genauer<br />
Betra<strong>ch</strong>tung we<strong>der</strong> als materiale no<strong>ch</strong> als prozedurale <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>,<br />
son<strong>der</strong>n sie sind <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sskepsis. Man könnte, weil sie die Antithese<br />
zur <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> enthalten, au<strong>ch</strong> von Antitheorien <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> spre<strong>ch</strong>en.<br />
II.<br />
Theorie des re<strong>ch</strong>tsethis<strong>ch</strong>en Relativismus (H. Kelsen)<br />
Man kann als <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sskeptiker zugestehen, daß die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> insofern etwas<br />
mit Re<strong>ch</strong>t zu tun hat, als sie ein Motiv für die Gestaltung <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tsordnung ist,<br />
und glei<strong>ch</strong>zeitig darauf bestehen, daß es sinnlos ist, über <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> zu spre<strong>ch</strong>en,<br />
weil vers<strong>ch</strong>iedene <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>skonzeptionen als glei<strong>ch</strong>ermaßen gültig o<strong>der</strong> ungültig<br />
angesehen werden müssen. Dies ist die Position des re<strong>ch</strong>tsethis<strong>ch</strong>en Relativismus,<br />
wie Kelsen ihn in <strong>der</strong> 'Reinen Re<strong>ch</strong>tslehre' entwickelt hat 12 . Das Re<strong>ch</strong>t ist dana<strong>ch</strong><br />
ein System von Zwangsnormen, das einer vorpositiven Re<strong>ch</strong>tfertigung ni<strong>ch</strong>t bedarf<br />
und ihrer au<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t fähig ist. Eine praktis<strong>ch</strong>e Vernunft, die Begründungen <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
generieren könnte, gibt es ni<strong>ch</strong>t 13 . Damit wird jede Politisierung und geisteswissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e<br />
Bewertung aus <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tslehre verbannt (juristis<strong>ch</strong>er Wertrelativismus)<br />
14 . Die Sollensanordnungen re<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er Normen gelten ohne den Rückgriff<br />
auf <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> 15 . Über diese re<strong>ch</strong>tspositivistis<strong>ch</strong>e Trennungsthese hinaus sagt Kelsen<br />
aber au<strong>ch</strong> Grundlegendes über die Mögli<strong>ch</strong>keit praktis<strong>ch</strong>er Vernunft: Was <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
inhaltli<strong>ch</strong> und absolut ist, entziehe si<strong>ch</strong> <strong>der</strong> mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Beurteilung; es<br />
11 Vgl. J. Habermas, Eintritt in die Postmo<strong>der</strong>ne: Nietzs<strong>ch</strong>e als Drehs<strong>ch</strong>eibe (1985), S. 119 f.: Nietzs<strong>ch</strong>e<br />
habe das »kritis<strong>ch</strong>e Vermögen <strong>der</strong> Werts<strong>ch</strong>ätzung ni<strong>ch</strong>t als ein Moment <strong>der</strong> Vernunft anerkannt,<br />
das wenigstens prozedural, im Verfahren argumentativer Begründung, mit objektivieren<strong>der</strong> Erkenntnis<br />
und moralis<strong>ch</strong>er Einsi<strong>ch</strong>t no<strong>ch</strong> zusammenhängt.«<br />
12 H. Kelsen, Das Problem <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1960), S. 357, 366 ff., sowie insbeson<strong>der</strong>e S. 403 f.: »Eine<br />
positivistis<strong>ch</strong>e und das heißt realistis<strong>ch</strong>e Re<strong>ch</strong>tslehre behauptet ni<strong>ch</strong>t – wie immer wie<strong>der</strong> betont<br />
werden muß –, daß es keine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> gebe, ... Sie leugnet ni<strong>ch</strong>t, daß die Gestaltung einer positiven<br />
Re<strong>ch</strong>tsordnung dur<strong>ch</strong> die Vorstellung irgendeiner <strong>der</strong> vielen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>snormen bestimmt<br />
werden kann und in <strong>der</strong> Regel tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> bestimmt wird.«<br />
13 H. Kelsen, Das Problem <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1960), S. 419 – Die praktis<strong>ch</strong>e Vernunft sei ein logis<strong>ch</strong><br />
ni<strong>ch</strong>t haltbarer Begriff. Ähnli<strong>ch</strong> bereits A. Ross, Kritik <strong>der</strong> sogenannten praktis<strong>ch</strong>en Vernunft<br />
(1933), S. 19: »Ganz glei<strong>ch</strong>, unter wel<strong>ch</strong>em Namen die praktis<strong>ch</strong>e Erkenntnis auftritt; [sie] ist in<br />
si<strong>ch</strong> wi<strong>der</strong>spru<strong>ch</strong>svoll. ... Das Ergebnis <strong>der</strong> Analyse: <strong>der</strong> sogenannte Begriff einer praktis<strong>ch</strong>en Erkenntnis<br />
ist kein e<strong>ch</strong>ter Begriff«.<br />
14 Zu dieser Bezei<strong>ch</strong>nung R. Dreier, Re<strong>ch</strong>t und <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1991), S. 99, 117 f.<br />
15 H. Kelsen, Das Problem <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1960), S. 402 ff.<br />
145


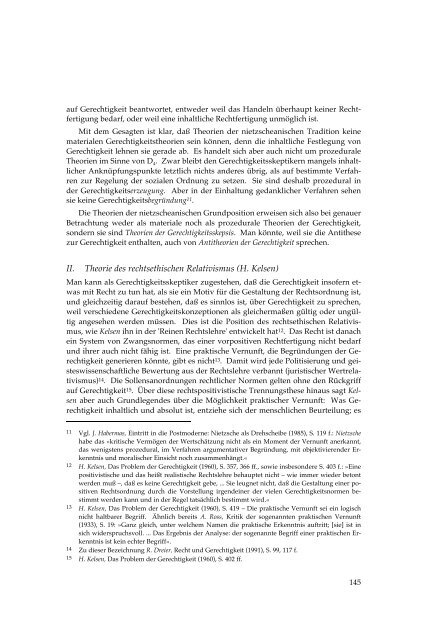



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









