Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
) Das Gefangenendilemma<br />
Wird mit <strong>der</strong> Spieltheorie das rationalistis<strong>ch</strong>e Ents<strong>ch</strong>eidungskalkül als einzige<br />
Grundlage sozialer Ordnung betra<strong>ch</strong>tet, dann müßte es genügen, diejenigen Normen<br />
mit staatli<strong>ch</strong>em Zwang dur<strong>ch</strong>zusetzen, die eine Marktordnung für egoistis<strong>ch</strong>e Nutzenmaximierer<br />
s<strong>ch</strong>ützen, also eine Sozialordnung im Sinne des libertären Na<strong>ch</strong>twä<strong>ch</strong>terstaates.<br />
Bereits die Analyse des Gefangenendilemmas zeigt, daß eine <strong>der</strong>artige<br />
Minimalstaatli<strong>ch</strong>keit die mögli<strong>ch</strong>en Kooperationsgewinne in <strong>der</strong> Gemeins<strong>ch</strong>aft<br />
ni<strong>ch</strong>t realisiert und darum ni<strong>ch</strong>t die bestmögli<strong>ch</strong>e soziale Ordnung begründen kann.<br />
Die Einzelheiten des Gefangenendilemmas sind so oft ges<strong>ch</strong>il<strong>der</strong>t worden, daß<br />
sie hier ni<strong>ch</strong>t wie<strong>der</strong>holt werden müssen 79 . Festzuhalten bleibt nur das bemerkenswerte<br />
Ergebnis: In einer ni<strong>ch</strong>tkooperativen Sozialsituation, in <strong>der</strong> die Beteiligten vollständig<br />
rational ihren je eigenen Vorteil verfolgen, kann das Ergebnis für jeden <strong>der</strong><br />
Beteiligten s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ter sein als bei einer Kooperation. Die Beteiligten wissen zwar,<br />
daß es eigentli<strong>ch</strong> für alle besser wäre, wenn sie gemeinsam ein Kooperationsziel verwirkli<strong>ch</strong>ten,<br />
do<strong>ch</strong> aufgrund <strong>der</strong> Ents<strong>ch</strong>eidungsgesetze individueller Nutzenmaximierung<br />
bleibt ihnen keine Wahl: sie müssen die Kooperation verweigern. Dadur<strong>ch</strong> entgeht<br />
ihnen ein real mögli<strong>ch</strong>er Kooperationsvorteil. Hätten die Beteiligten ni<strong>ch</strong>t die<br />
Position individueller Nutzenmaximierer eingenommen, son<strong>der</strong>n si<strong>ch</strong> aus Tugendhaftigkeit<br />
(d.h. 'aristotelis<strong>ch</strong>') o<strong>der</strong> aus Moralität (d.h. 'kantis<strong>ch</strong>') nutzenunabhängig<br />
für die Kooperation ents<strong>ch</strong>ieden, dann ginge es ihnen im Ergebnis besser. Eine staatli<strong>ch</strong>e<br />
Ordnung, die au<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong>e Kooperationsvorteile no<strong>ch</strong> realisieren will, kann folgli<strong>ch</strong><br />
ni<strong>ch</strong>t allein dem freien Spiel <strong>der</strong> Kräfte seinen Lauf lassen, son<strong>der</strong>n muß die Rahmenbedingungen<br />
für »unbedingte Kooperation« setzen 80 . Der Staat muß s<strong>ch</strong>on aus<br />
pragmatis<strong>ch</strong>en Gründen jenseits minimalstaatli<strong>ch</strong>en Integritätss<strong>ch</strong>utzes au<strong>ch</strong> die Sittli<strong>ch</strong>keit<br />
o<strong>der</strong> Moralität för<strong>der</strong>n, um zusätzli<strong>ch</strong>e Kooperationsvorteile gegenüber individualistis<strong>ch</strong>er<br />
Nutzenmaximierung zu si<strong>ch</strong>ern.<br />
c) Das Beitragsdilemma bei öffentli<strong>ch</strong>en Gütern (D. Parfit)<br />
Ein weiterer Regelungsberei<strong>ch</strong>, in dem si<strong>ch</strong> die Inadäquatheit <strong>der</strong> Spieltheorie als<br />
Grundlage einer <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie erweist, ist die Si<strong>ch</strong>erung öffentli<strong>ch</strong>er Güter 81 .<br />
Das hier zu beoba<strong>ch</strong>tende Beitragsdilemma kann als volkswirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>er Son<strong>der</strong>fall<br />
des Gefangenendilemmas angesehen werden.<br />
79 Darstellungen etwa bei R. Axelrod/W.D. Hamilton, Evolution of Cooperation (1981), S. 1391 ff.;<br />
O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1987), S. 420 ff.; G. Kir<strong>ch</strong>gässner, Homo oeconomicus (1991), S. 50<br />
ff. m.w.N.; L. Kern/J. Nida-Rümelin, Logik kollektiver Ents<strong>ch</strong>eidungen (1994), S. 201 ff. m.w.<br />
Beispielen. Eine weniger bekannte Variante des Gefangenendilemmas hat Hardin für die<br />
Nutzung öffentli<strong>ch</strong>er Güter ges<strong>ch</strong>il<strong>der</strong>t; G.J. Hardin, The Tragedy of the Commons (1968), S. 1243<br />
80 ff. Vgl. L. Kern/J. Nida-Rümelin, Logik kollektiver Ents<strong>ch</strong>eidungen (1994), S. 227 ff. (228).<br />
81 Der Begriff <strong>der</strong> 'öffentli<strong>ch</strong>en Güter' ist umstritten. W. Blümel/R. Pethig/O. v.d.Hagen, Theory of<br />
Public Goods (1986), S. 242 haben im wesentli<strong>ch</strong>en drei Begriffsverwendungen ausgema<strong>ch</strong>t: öffentli<strong>ch</strong>e<br />
Güter als alle Gegenstände, bei <strong>der</strong>en Zurverfügungstellung ein Marktversagen eintreten<br />
kann; öffentli<strong>ch</strong>e Güter als öffentli<strong>ch</strong> vorgehaltene Güter; öffentli<strong>ch</strong>e Güter als alle Gegenstände,<br />
die zur Verfügung aller stehen und gemeins<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong> verbrau<strong>ch</strong>t werden. Auf die Feinheiten <strong>der</strong><br />
Abgrenzung (ebd., S. 245 ff.) kann hier verzi<strong>ch</strong>tet werden, da Parfits Beitragsdilemma für alle diese<br />
Fälle gilt.<br />
276


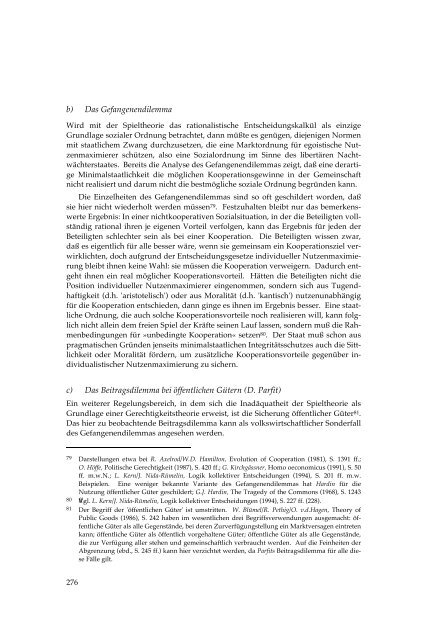



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









