Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
was genau eine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie zu einer prozeduralen ma<strong>ch</strong>t 4 . Die Arbeiten behandeln<br />
zwar einen unumstrittenen Kernbestand <strong>der</strong> prozeduralen <strong>Theorien</strong>gruppe,<br />
zu dem die Ents<strong>ch</strong>eidungs- und Diskurstheorien sowie einige Vertragstheorien gehören<br />
5 . Sie konkretisieren aber ni<strong>ch</strong>t die Grenzen <strong>der</strong> <strong>Theorien</strong>klasse. Ist eine Theorie<br />
s<strong>ch</strong>on dann 'prozedural', wenn sie, wie im Utilitarismus, ein inhaltsunabhängiges,<br />
rein formales Kriterium für <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> bestimmt – 'Das größte Glück <strong>der</strong> größten<br />
Zahl'? 6 Liegt eine 'prozedurale' <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie vor, wenn eine Theorie für die<br />
Erzeugung gere<strong>ch</strong>ter Ergebnisse auf Verfahren abstellt, etwa auf den Geri<strong>ch</strong>tsprozeß<br />
o<strong>der</strong> das Gesetzgebungsverfahren? Müssen wir von 'prozeduralen' <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien<br />
au<strong>ch</strong> dort spre<strong>ch</strong>en, wo in grundlegen<strong>der</strong> Vernunftskepsis die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sfragen<br />
als unents<strong>ch</strong>eidbar gelten und auf Verfahren nur als Notlösung zurückgegriffen<br />
wird?<br />
Alle diese Fragen sind mit 'Nein' zu beantworten. Um aber eine sol<strong>ch</strong>e Antwort<br />
geben zu können, muß erst einmal <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> prozeduralen Theorie <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
bestimmt werden. Das geht nur innerhalb eines analytis<strong>ch</strong>en Rahmens zu den Begriffen<br />
von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>, <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie und prozeduraler <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>, <strong>der</strong><br />
trotz zahlrei<strong>ch</strong>er Einzelstudien zu Theoriegruppen erst no<strong>ch</strong> ges<strong>ch</strong>affen werden<br />
will 7 . Sol<strong>ch</strong>en terminologis<strong>ch</strong>en und klassifikatoris<strong>ch</strong>en Fragen ist <strong>der</strong> zweite Teil<br />
tizität und Geltung (1992), S. 564; R. Hoffmann, Verfahrensgere<strong>ch</strong>tigkeit (1992), S. 166 ff.; M.R. Deckert,<br />
Folgenorientierung in <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tsanwendung (1995), S. 194; H. Klenner, Über die vier Arten<br />
von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien gegenwärtiger Re<strong>ch</strong>tsphilosophie (1995), S. 138 ff. Parallelen finden<br />
si<strong>ch</strong> in den Begriffen 'prozedurale Ethik', 'prozedurale Methodik' und 'prozedurale Re<strong>ch</strong>tfertigung',<br />
vgl. H. Kits<strong>ch</strong>elt, Moralis<strong>ch</strong>es Argumentieren und Sozialtheorie (1980), S. 391 ff.; S. Benhabib,<br />
The Methodological Illusions of Mo<strong>der</strong>n Political Theory (1982), S. 49; J.-R. Sieckmann, Justice and<br />
Rights (1995), S. 110 f.<br />
4 R. Dreier, Re<strong>ch</strong>t und <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1991), S. 107, 111 ff. spri<strong>ch</strong>t beispielsweise von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegründungs-<br />
und <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>serzeugungstheorien, während A. Kaufmann, <strong>Prozedurale</strong> <strong>Theorien</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. 13 ff. allein die Beispiele <strong>der</strong> Begründungstheorien von J. Rawls<br />
und J. Habermas heranzieht. Dazu unten S. 132 ff. (Begriff <strong>der</strong> prozeduralen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie).<br />
5 Zu alledem später ausführli<strong>ch</strong> S. 167 ff. (Ents<strong>ch</strong>eidungstheorien), S. 217 ff. (Diskurstheorien); zum<br />
Problem <strong>der</strong> Vertragstheorien als <strong>Theorien</strong>klasse außerdem S. 102.<br />
6 Vgl. J. Bentham, Fragment of Government (1776), S. 242: »As a basis for all su<strong>ch</strong> operations ... may<br />
be seen setting up accordingly, the greatest happiness of the greatest number, in the <strong>ch</strong>aracter of<br />
the proper, and only proper and defensible, end of government« sowie S. 271, Anm.: »[T]he greatest-happiness<br />
principle [is] a principle whi<strong>ch</strong> lays down, as the only right and justifiable end of Government,<br />
the greatest happiness of the greatest number« (Hervorhebung bei Bentham). Vgl. <strong>der</strong>s.,<br />
Codification Proposal (1822), S. 537 ff. – die 'greatest happiness of the greatest number' for<strong>der</strong>e eine<br />
umfassende Institutionalisierung von Re<strong>ch</strong>t, das im einzelnen mit <strong>der</strong> Glücksför<strong>der</strong>ung begründet<br />
sein müsse; <strong>der</strong>s., Constitutional Code (1827), S. 5: »The right and proper end of government in<br />
every political community is the greatest happiness of the greatest number.«<br />
7 Der Vortrag von A. Kaufmann, <strong>Prozedurale</strong> <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. 13 ff. bes<strong>ch</strong>ränkt<br />
si<strong>ch</strong> auf eine verglei<strong>ch</strong>ende Darstellung <strong>der</strong> <strong>Theorien</strong> von Habermas und Rawls. Die zahlrei<strong>ch</strong>en<br />
neueren Studien zu Sozialvertragstheorien beziehen Diskursmodelle ni<strong>ch</strong>t mit ein; vgl. etwa P.<br />
Koller, <strong>Theorien</strong> des Sozialkontrakts als Re<strong>ch</strong>tfertigungsmodelle politis<strong>ch</strong>er Institutionen (1984), S.<br />
241 ff.; <strong>der</strong>s., Neue <strong>Theorien</strong> des Sozialkontrakts (1987), S. 11 ff.; V. Medina, Social Contract Theories<br />
(1990), S. 11 ff. (<strong>Theorien</strong> von Hobbes, Locke, Rousseau, Kant und Rawls mit einer Gegenüberstellung<br />
zu Hume und Hegel); R. Kley, Vertragstheorien <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. VIII ff. (Rawls, Nozick,<br />
Bu<strong>ch</strong>anan); W. Kersting, Die politis<strong>ch</strong>e Philosophie des Gesells<strong>ch</strong>aftsvertrags (1994), S. 11 ff.<br />
Die Arbeit von J. Habermas, Faktizität und Geltung (1992) konzentriert si<strong>ch</strong> auf eine Abgrenzung<br />
zur Theorie von Rawls. Die verglei<strong>ch</strong>enden Arbeiten zu Vertrag und Diskurs, etwa die ents<strong>ch</strong>ei-<br />
22


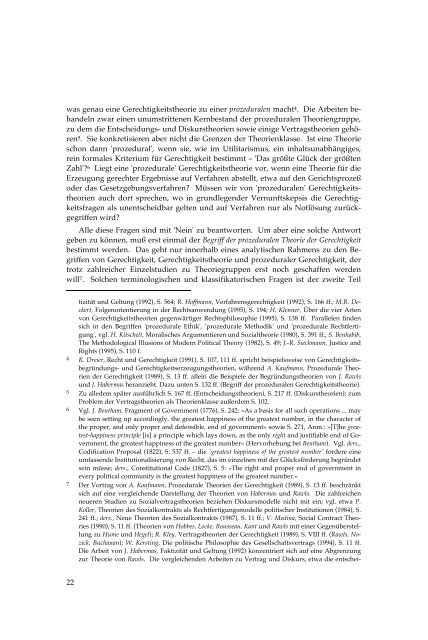



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









