Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
kantis<strong>ch</strong>en Grundposition kennzei<strong>ch</strong>nend ist, wird dabei dur<strong>ch</strong> die Distanzierung<br />
von den Interessen <strong>der</strong> eigenen Person errei<strong>ch</strong>t. Der Beoba<strong>ch</strong>ter sieht ni<strong>ch</strong>t auss<strong>ch</strong>ließli<strong>ch</strong><br />
o<strong>der</strong> in erster Linie si<strong>ch</strong> allein, son<strong>der</strong>n glei<strong>ch</strong>zeitig immer alle an<strong>der</strong>en.<br />
Er kann darum idealerweise nur sol<strong>ch</strong>e Urteile abgeben, die für alle ri<strong>ch</strong>tig sind. Das<br />
Darstellungsmittel des Beoba<strong>ch</strong>ters ist klassis<strong>ch</strong> für <strong>Theorien</strong> des Utilitarismus, kann<br />
aber au<strong>ch</strong> für <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> kantis<strong>ch</strong>en Grundposition fru<strong>ch</strong>tbar gema<strong>ch</strong>t werden.<br />
Als typis<strong>ch</strong>es Beispiel einer sol<strong>ch</strong>en Theorie kann die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie Nagels<br />
herangezogen werden 416 .<br />
Im übrigen gibt es eine Reihe von Standpunkttheorien, die im Gegensatz zu Konsenstheorien<br />
monologis<strong>ch</strong> arbeiten, also we<strong>der</strong> den Sozialvertrag, no<strong>ch</strong> den Diskurs<br />
als Darstellungsmittel nutzen 417 . An<strong>der</strong>erseits kennen diese <strong>Theorien</strong> aber au<strong>ch</strong> keine<br />
Beoba<strong>ch</strong>terperspektive. Sie sind reine Moraltheorien im engeren Sinne und verzi<strong>ch</strong>ten<br />
ganz auf ein klassis<strong>ch</strong>es Darstellungsmittel, son<strong>der</strong>n fragen direkt na<strong>ch</strong><br />
Gründen für die Ri<strong>ch</strong>tigkeit des Handelns. Denno<strong>ch</strong> glei<strong>ch</strong>en sie den Beoba<strong>ch</strong>tertheorien,<br />
weil sie <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>süberlegungen monologis<strong>ch</strong> anstellen, statt dialogis<strong>ch</strong><br />
auf Konsens zu setzen. Ein neuerer Ansatz ist insoweit von Barry bes<strong>ch</strong>ritten worden<br />
418 .<br />
1. Theorie des unparteiis<strong>ch</strong>en Beoba<strong>ch</strong>ters (T. Nagel)<br />
a) Der interne und <strong>der</strong> externe Standpunkt<br />
Nagel knüpft seine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie insgesamt an die Frage, wie die Perspektive<br />
einer einzelnen Person in <strong>der</strong> realen Welt mit einer objektiven Betra<strong>ch</strong>tung <strong>der</strong>selben<br />
Welt in Einklang zu bringen ist 419 . Damit sind zwei Standpunkte angespro<strong>ch</strong>en, die<br />
ein Individuum einnehmen kann: <strong>der</strong> subjektive, interne, parteiis<strong>ch</strong>e und <strong>der</strong> objektive,<br />
externe, unparteiis<strong>ch</strong>e 420 . Der externe Standpunkt begründet notwendig einen<br />
hypothetis<strong>ch</strong>en Zustand <strong>der</strong> Unvoreingenommenheit und Unparteili<strong>ch</strong>keit des Beoba<strong>ch</strong>ters<br />
421 . Diese objektivierende Perspektive spielt bei <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tfertigung von<br />
Handlungsweisen, also für Fragen <strong>der</strong> praktis<strong>ch</strong>en Vernunft, laut Nagel eine wi<strong>ch</strong>tileidens<strong>ch</strong>aftslosen,<br />
neutralen Beoba<strong>ch</strong>ters. Wenn wir von einem sol<strong>ch</strong>en Standpunkt gewissermaßen<br />
mit Gottes Augen beoba<strong>ch</strong>ten, dann können wir sehen, 'Du sollst ni<strong>ch</strong>t töten' hält.« Ähnli<strong>ch</strong><br />
T. Nagel, View From Nowhere (1986), S. 185 ff. Zu klassis<strong>ch</strong>en Vorbil<strong>der</strong>n (etwa Hume; dazu oben<br />
S. 100, Fn. 280) vgl. K.G. Ballestrem, Methodologis<strong>ch</strong>e Probleme in Rawls' Theorie <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
(1977), S. 120.<br />
416 Dies zeigt si<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on im Titel des Werks: 'The View From Nowhere'.<br />
417 Etwa das fiktive Gedankenspiel bei E. Brunner, <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1943), S. 29 f.<br />
418 B. Barry, Justice as Impartiality (1995). Dazu unten S. 215 ff. (<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als Unparteili<strong>ch</strong>keit).<br />
419 T. Nagel, View From Nowhere (1986), S. 3: »This book is about a single problem: how to combine<br />
the perspective of a particular person inside the world with an objective view of that same world,<br />
the person and his viewpoint included.« Diese Konzeption hat Nagel in 'Equality and Impartiality'<br />
(1991) konkretisiert.<br />
420 T. Nagel, View From Nowhere (1986), S. 3; zur Glei<strong>ch</strong>setzung des 'objektiven' mit dem 'externen'<br />
Standpunkt vgl. ebd., S. 110. Au<strong>ch</strong> Hume berücksi<strong>ch</strong>tigte beide Standpunkte; dazu oben S. 101,<br />
Fn. 285.<br />
421 T. Nagel, Equality and Impartiality (1991), S. 10 ff. Vgl. oben S. 100 (Beoba<strong>ch</strong>ter).<br />
212


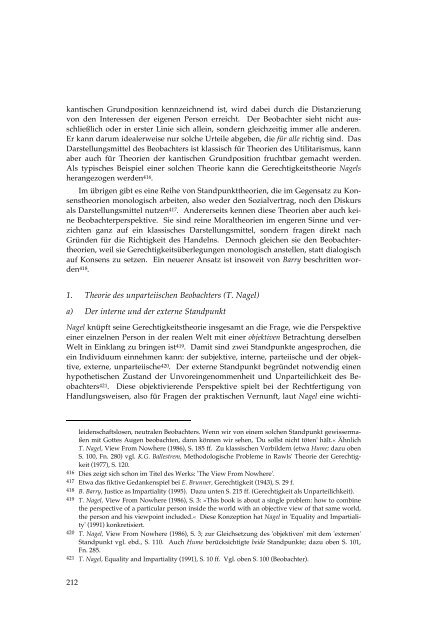



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









