Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erfolg des einzelnen ni<strong>ch</strong>t nur vom eigenen Handeln, son<strong>der</strong>n au<strong>ch</strong> von den<br />
Aktionen an<strong>der</strong>er abhängt.« 201<br />
Die Antwort auf die erste Frage wird im Grundsatz einheitli<strong>ch</strong> beantwortet, denn<br />
sie kann direkt aus <strong>der</strong> ents<strong>ch</strong>eidungstheoretis<strong>ch</strong>en Konzeption <strong>der</strong> praktis<strong>ch</strong>en Vernunft<br />
(T RC ) abgeleitet werden. Die Grenze für weitergehende Kooperation und damit<br />
glei<strong>ch</strong>zeitig <strong>der</strong> ri<strong>ch</strong>tige Grad von Kooperation ist dann errei<strong>ch</strong>t, wenn jede weitergehende<br />
Kooperation, die einen Vorteil für mindestens einen Beteiligten bedeutet,<br />
glei<strong>ch</strong>zeitig für mindestens einen an<strong>der</strong>en Beteiligten na<strong>ch</strong>teilig wäre. Das Kriterium<br />
für die Ri<strong>ch</strong>tigkeit eines We<strong>ch</strong>sels von einem Weniger zu einem Mehr an Kooperation<br />
ist also dasjenige <strong>der</strong> Pareto-Optimalität 202 . Damit wird indes nur <strong>der</strong> Grad, ni<strong>ch</strong>t<br />
hingegen die konkrete Art <strong>der</strong> Kooperation bestimmt, denn es gibt eine Vielzahl von<br />
Kooperationskonstellationen, die alle Pareto-optimal sind, bei denen also niemand<br />
etwas gewinnen kann, ohne daß glei<strong>ch</strong>zeitig ein an<strong>der</strong>er etwas verliert. Das Kriterium<br />
ist denno<strong>ch</strong> wi<strong>ch</strong>tig, denn es bildet in Ents<strong>ch</strong>eidungstheorien den Ausgangspunkt<br />
für die Kritik an wohlfahrtsstaatli<strong>ch</strong>en Umverteilungstendenzen: Die Solidarität<br />
<strong>der</strong> 'Starken' mit den 'S<strong>ch</strong>wa<strong>ch</strong>en' ist na<strong>ch</strong> <strong>der</strong> ents<strong>ch</strong>eidungstheoretis<strong>ch</strong>en<br />
Konzeption praktis<strong>ch</strong>er Vernunft nur in denjenigen Fällen gere<strong>ch</strong>tfertigt, in denen sie<br />
für jeden Beteiligten (d.h. au<strong>ch</strong> für die leistungsfähigen 'Starken') vorteilhaft ist.<br />
Die Antwort auf die zweite Frage wird von den einzelnen <strong>Theorien</strong> rationalen<br />
Ents<strong>ch</strong>eidens unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong> beantwortet. Es gibt vom Standpunkt <strong>der</strong> hobbesianis<strong>ch</strong>en<br />
Grundposition mehrere Mögli<strong>ch</strong>keiten, eine ri<strong>ch</strong>tige (gere<strong>ch</strong>te) Verteilung <strong>der</strong><br />
Kooperationsgewinne zu begründen. Die Su<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> den Kriterien für diese Verteilung<br />
von Kooperationsgewinnen entwickelt si<strong>ch</strong> zur Zentralfrage aller Ents<strong>ch</strong>eidungstheorien.<br />
Die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien <strong>der</strong> hobbesianis<strong>ch</strong>en Tradition werden<br />
im folgenden daraufhin untersu<strong>ch</strong>t und dana<strong>ch</strong> eingeteilt, wel<strong>ch</strong>e Antwort sie auf<br />
diese Frage geben.<br />
II.<br />
<strong>Theorien</strong> zur Optimierung relativer Nutzenfaktoren<br />
Ältere Sozialvertragstheorien haben zur Begründung sozialer Ordnung regelmäßig<br />
das Bild des Naturzustands bemüht, um einen vorpolitis<strong>ch</strong>en Ausgangspunkt zu<br />
gewinnen, von dem aus si<strong>ch</strong> die Ents<strong>ch</strong>eidung für eine staatli<strong>ch</strong>e Ordnung als rational<br />
erweist 203 . Je s<strong>ch</strong>limmer dieser Naturzustand ges<strong>ch</strong>il<strong>der</strong>t werden konnte, je<br />
glaubwürdiger er si<strong>ch</strong> als »Krieg aller gegen alle« 204 erwies, <strong>der</strong> das Leben <strong>der</strong> Men-<br />
201 W. Güth, Spieltheorie (1997), S. 3512. Dazu im einzelnen unten S. 270 ff. (Kritik spieltheoretis<strong>ch</strong>er<br />
Grundlegung).<br />
202 Dazu unten S. 273 (zwei Bedingungen rationaler Verhandlung).<br />
203 Zur aktuellen Bedeutung des Naturzustands in <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegründung siehe R. Nozick,<br />
Anar<strong>ch</strong>y, State, and Utopia (1974), S. 6 ff.<br />
204 Ein 'bellum omnia contra omnes' findet si<strong>ch</strong> erstmals bei T. Hobbes, Vom Bürger (1642), Vorwort:<br />
»Darauf zeige i<strong>ch</strong> nun, daß <strong>der</strong> Zustand <strong>der</strong> Mens<strong>ch</strong>en außerhalb <strong>der</strong> bürgerli<strong>ch</strong>en Gesells<strong>ch</strong>aft<br />
(den i<strong>ch</strong> den Naturzustand zu nennen mir erlaube) nur <strong>der</strong> Krieg aller gegen alle ist, und daß in<br />
diesem Kriege alle ein Re<strong>ch</strong>t auf alles haben.« Der Gedanke wird wie<strong>der</strong> aufgegriffen in <strong>der</strong>s., Leviathan<br />
(1651), Kapitel 13: »Hereby it is manifest, that during the time men live without a common<br />
Power to keep them all in awe, they are in that condition whi<strong>ch</strong> is called Warre; and su<strong>ch</strong> a<br />
warre, as is of every man, against every man. ... Whatsoever therefore is consequent to a time of<br />
171


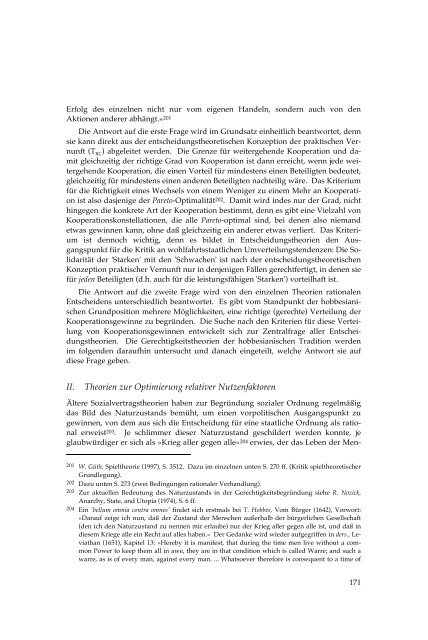



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









