Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wel<strong>ch</strong>en Bedingungen ihre Ergebnisse falsifizierbar sind 156 . Soweit diskurstheoretis<strong>ch</strong><br />
begründete Anfor<strong>der</strong>ungen bestimmt werden können, unter denen reale Diskurse<br />
relativ zu ihren Bedingungen (Zeitpunkt, Teilnehmer, Dauer u.v.m.) ri<strong>ch</strong>tige<br />
und damit gere<strong>ch</strong>te Ergebnisse hervorbringen, ist allein in dieser Bedingungsdefinition<br />
ein Erkenntnisgewinn zu sehen 157 . Diskursive Überprüfung führt zwar ni<strong>ch</strong>t in<br />
den Berei<strong>ch</strong> <strong>der</strong> Si<strong>ch</strong>erheit, aber immerhin aus dem Berei<strong>ch</strong> des bloßen Meinens hinaus<br />
158 . Außerdem bietet das diskurstheoretis<strong>ch</strong>e Erkenntnismodell die Mögli<strong>ch</strong>keit,<br />
Normen ni<strong>ch</strong>t nur in Diskursen, son<strong>der</strong>n au<strong>ch</strong> unabhängig von konkreten Diskursen zu<br />
begründen 159 . Insoweit kann ni<strong>ch</strong>t nur relative, son<strong>der</strong>n absolute Ri<strong>ch</strong>tigkeit geltend<br />
gema<strong>ch</strong>t werden, was unter an<strong>der</strong>em die diskurstheoretis<strong>ch</strong>e Begründung universeller<br />
Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te mögli<strong>ch</strong> ma<strong>ch</strong>t 160 .<br />
Zur dritten Kritik: Eine grundlegende Kritik liegt in <strong>der</strong> Behauptung, die Einhaltung<br />
von Diskursregeln habe mit Ri<strong>ch</strong>tigkeit überhaupt ni<strong>ch</strong>ts zu tun, weil ni<strong>ch</strong>t zu<br />
beweisen sei, daß formale Verfahrensregeln eine Annäherung an inhaltli<strong>ch</strong>e Ri<strong>ch</strong>tigkeit<br />
bewirken könnten (Konvergenzbeweis 161 ). Die gefor<strong>der</strong>te Konvergenz ist »die<br />
Ineinssetzung vers<strong>ch</strong>iedener, von vers<strong>ch</strong>iedenen Subjekten herrühren<strong>der</strong> und untereinan<strong>der</strong><br />
unabhängiger Erkenntnisse von demselben Seienden.« 162 Sie soll »ni<strong>ch</strong>t nur<br />
ein Mittel zur Erkenntnis des Konkreten, son<strong>der</strong>n au<strong>ch</strong> ein Kriterium <strong>der</strong> Wahrheit«<br />
sein 163 . Worin eine sol<strong>ch</strong>e Konvergenz zu sehen ist, kann unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong> beurteilt<br />
werden. Es sind zwei Formen <strong>der</strong> Annäherung vorstellbar, <strong>der</strong>en eine uneinlösbar<br />
und <strong>der</strong>en an<strong>der</strong>e, entgegen <strong>der</strong> Idee <strong>der</strong> Konvergenztheorie 164 , inhaltsleer ist. Uneinlösbar<br />
ist die For<strong>der</strong>ung, praktis<strong>ch</strong>e Erkenntnis müsse in einem Prozeß stetiger<br />
Annäherung erfolgen, also so, daß jedes neue (Zwis<strong>ch</strong>en-)Ergebnis garantiert näher<br />
an <strong>der</strong> wirkli<strong>ch</strong>en Ri<strong>ch</strong>tigkeit o<strong>der</strong> Wahrheit, dem 'Seienden an si<strong>ch</strong>' 165 , liegt als alle<br />
vorausgegangenen 166 . Mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Fehlbarkeit s<strong>ch</strong>ließt eine sol<strong>ch</strong>e irrtumsfreie Ziel-<br />
156 Dazu oben S. 264, Fn. 20.<br />
157 Dazu unten S. 312 ff. (Begründung von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>snormen; mittelbare Begründung).<br />
158 R. Alexy, Theorie <strong>der</strong> juristis<strong>ch</strong>en Argumentation (1991), S. 416.<br />
159 Dazu unten S. 310 ff. (Begründung von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>snormen; unmittelbare Begründung).<br />
160 Dazu unten S. 317 ff. (Begründung von Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>ten und Demokratie).<br />
161 A. Kaufmann, Über die Wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>keit <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tswissens<strong>ch</strong>aft (1986), S. 440 ff.; <strong>der</strong>s., Re<strong>ch</strong>t<br />
und Rationalität (1988), S. 34 ff.<br />
162 A. Kaufmann, Über die Wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>keit <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tswissens<strong>ch</strong>aft (1986), S. 441.<br />
163 A. Kaufmann, Über die Wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>keit <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tswissens<strong>ch</strong>aft (1986), S. 441 (Hervorhebung<br />
bei Kaufmann).<br />
164 Die Konvergenztheorie will si<strong>ch</strong> von prozeduralen <strong>Theorien</strong> ja gerade dadur<strong>ch</strong> abgrenzen, daß ihre<br />
Inhalte ni<strong>ch</strong>t 'ers<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en' sind; vgl. A. Kaufmann, Re<strong>ch</strong>t und Rationalität (1988), S. 34; <strong>der</strong>s., <strong>Prozedurale</strong><br />
<strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. 11 ff. Mittels <strong>der</strong> Anerkennung <strong>der</strong> Person will sie<br />
den formal definierten Diskurs um einen Gehalt erweitern und so »das Fundament einer sa<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
begründeten prozeduralen Theorie ri<strong>ch</strong>tigen Re<strong>ch</strong>ts« legen; A. Kaufmann, Über die Wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>keit<br />
<strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tswissens<strong>ch</strong>aft (1986), S. 442 (Hervorhebung bei Kaufmann).<br />
165 A. Kaufmann, Über die Wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>keit <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tswissens<strong>ch</strong>aft (1986), S. 441.<br />
166 Von dieser Art <strong>der</strong> stetigen Kovergenz s<strong>ch</strong>eint Kaufmann auszugehen; vgl. A. Kaufmann, Über die<br />
Wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>keit <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tswissens<strong>ch</strong>aft (1986), S. 441: Es gelte, »daß die subjektiven Momente<br />
si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t wie<strong>der</strong> na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong> zu einer Einheit zusammens<strong>ch</strong>ließen lassen, son<strong>der</strong>n, gegeneinan<strong>der</strong><br />
gehalten, si<strong>ch</strong> gegenseitig abs<strong>ch</strong>wä<strong>ch</strong>en o<strong>der</strong> sogar aufheben. Die objektiven Momente weisen<br />
dagegen alle auf den Einheitspunkt des Seienden an si<strong>ch</strong> hin und bewähren si<strong>ch</strong> so als begründet.«<br />
293


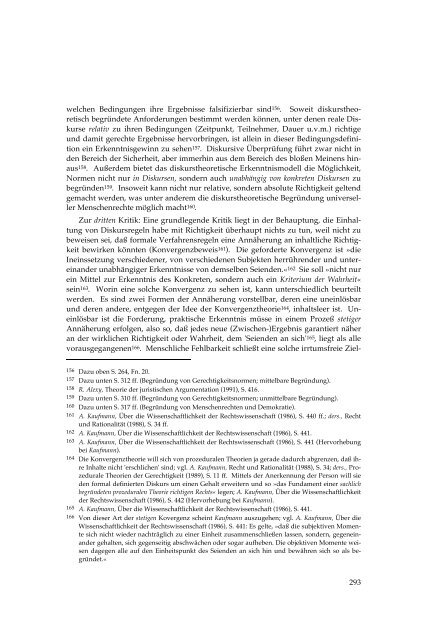



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









