Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
unters<strong>ch</strong>eidet die hier vorgenommene Begriffsbestimmung von an<strong>der</strong>en, engeren<br />
Ansätzen 46 .<br />
3. Der Sollensbezug (D 1D D 1A )<br />
Neben dem Handlungs- und Ri<strong>ch</strong>tigkeitsbezug besteht bei allen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>surteilen<br />
begriffsnotwendig ein Sollensbezug, <strong>der</strong> im Merkmal <strong>der</strong> 'Pfli<strong>ch</strong>tigkeit' ausgedrückt<br />
ist. Die Vornahme <strong>der</strong> gere<strong>ch</strong>ten Handlung ist für den Handelnden eine moralis<strong>ch</strong>e<br />
Pfli<strong>ch</strong>t, und die Gegenseite hat auf sie ein moralis<strong>ch</strong>es Re<strong>ch</strong>t 47 . Wer sagt, es<br />
gebe nur eine einzige gere<strong>ch</strong>te Handlungsalternative, <strong>der</strong> drückt damit glei<strong>ch</strong>zeitig<br />
aus, daß diese Handlung vorgenommen werden muß. Wer behauptet, er sei ungere<strong>ch</strong>t<br />
behandelt worden, <strong>der</strong> rügt glei<strong>ch</strong>zeitig eine Verletzung seiner (moralis<strong>ch</strong>en)<br />
Re<strong>ch</strong>te. Dur<strong>ch</strong> diesen doppelten begriffsimmanenten Sollensbezug (Pfli<strong>ch</strong>t und Re<strong>ch</strong>t)<br />
unters<strong>ch</strong>eidet si<strong>ch</strong> die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> in D 1 von Nä<strong>ch</strong>stenliebe, Großzügigkeit, Barmherzigkeit,<br />
Sympathie, Mitleid, Solidarität, Dankbarkeit, Freunds<strong>ch</strong>aft, Vergebung o<strong>der</strong> Liebe 48 .<br />
Wer beispielsweise sagt, er habe aus Nä<strong>ch</strong>stenliebe gehandelt, <strong>der</strong> impliziert (wie bei<br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>) die Ri<strong>ch</strong>tigkeit des Handelns. Denno<strong>ch</strong> wäre ein Akt <strong>der</strong> Nä<strong>ch</strong>stenliebe<br />
keine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> im Sinne von D 1 , denn selbst wenn eine moralis<strong>ch</strong>e<br />
Handlungspfli<strong>ch</strong>t aus <strong>der</strong> Nä<strong>ch</strong>stenliebe folgen sollte, so könnte sie jedenfalls ni<strong>ch</strong>t<br />
eingefor<strong>der</strong>t werden. Sie wäre nur eine einseitige Tugendpfli<strong>ch</strong>t 49 .<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> wird dur<strong>ch</strong> den Sollensbezug zu einem Teil <strong>der</strong> Moral 50 . Dieses<br />
Spezialitätsverhältnis läßt si<strong>ch</strong> – unabhängig davon, wie weit o<strong>der</strong> eng man den Begriff<br />
<strong>der</strong> Moral im übrigen faßt 51 – folgen<strong>der</strong>maßen skizzieren 52 :<br />
46 An<strong>der</strong>s etwa die Begriffsbestimmung von O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1987), S. 54 f., na<strong>ch</strong><br />
<strong>der</strong> die rein pragmatis<strong>ch</strong>e Rationalität des Utilitarismus s<strong>ch</strong>on begriffli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t als <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
verstanden werden könne.<br />
47 Zu dieser (moralis<strong>ch</strong>en, ni<strong>ch</strong>t notwendig au<strong>ch</strong> juristis<strong>ch</strong>en) 'Re<strong>ch</strong>tspfli<strong>ch</strong>tigkeit' vgl. O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1987), S. 56 ff.: Moralphilosophis<strong>ch</strong> werde bei <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> von Re<strong>ch</strong>tspfli<strong>ch</strong>ten<br />
gespro<strong>ch</strong>en, also von sol<strong>ch</strong>en moralis<strong>ch</strong>en Pfli<strong>ch</strong>ten, <strong>der</strong>en Erfüllung die Gegenseite einfor<strong>der</strong>n<br />
kann, während im übrigen in <strong>der</strong> Moral nur (einseitige) Tugendpfli<strong>ch</strong>ten bestünden. Die moralis<strong>ch</strong>e<br />
Pfli<strong>ch</strong>t und ihre Einfor<strong>der</strong>ung beziehe si<strong>ch</strong> dabei auf die Vornahme <strong>der</strong> Handlung, ni<strong>ch</strong>t<br />
hingegen auf die moralis<strong>ch</strong>en Motive des Handelns.<br />
48 Vgl. die Gegenüberstellung bei W.K. Frankena, The Concept of Social Justice (1962), S. 4 und J.R.<br />
Lucas, Principles of Politics (1966), S. 234 sowie die Aufzählung bei O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
(1987), S. 55 f.<br />
49 Vgl. O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1987), S. 56 f.<br />
50 Vgl. H. Kelsen, Das Problem <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1960), S. 357: »[I]nsofern liegt <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> innerhalb<br />
des Berei<strong>ch</strong>es <strong>der</strong> Moral.«<br />
51 Auf die damit angespro<strong>ch</strong>enen terminologis<strong>ch</strong>en Differenzen kann hier ni<strong>ch</strong>t ausführli<strong>ch</strong> eingegangen<br />
werden. Hier wird, wie bei Habermas, für die Frage praktis<strong>ch</strong>er Philosophie (»Was soll i<strong>ch</strong><br />
tun?«) zwis<strong>ch</strong>en pragmatis<strong>ch</strong>er, ethis<strong>ch</strong>er und moralis<strong>ch</strong>er Perspektive mit den ihnen entspre<strong>ch</strong>enden<br />
Gegenständen des Zweckmäßigen, des Guten und des Gere<strong>ch</strong>ten unters<strong>ch</strong>ieden –<br />
J. Habermas, Vom pragmatis<strong>ch</strong>en, ethis<strong>ch</strong>en und moralis<strong>ch</strong>en Gebrau<strong>ch</strong> <strong>der</strong> praktis<strong>ch</strong>en Vernunft<br />
(1988), S. 100 ff.; dazu unten S. 92 ff. (Vernunftgebrau<strong>ch</strong>). Unter allen praktis<strong>ch</strong>en Fragen heben<br />
si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> Habermas die moralis<strong>ch</strong>en dadur<strong>ch</strong> heraus, daß sie einer vernünftigen Begründung zugängli<strong>ch</strong><br />
seien; dies seien aber nur die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sfragen, weil evaluative Aussagen über das<br />
(eigene) gute Leben ni<strong>ch</strong>t weiter begründbare Präferenzen ausdrückten; J. Habermas, Moralität<br />
und Sittli<strong>ch</strong>keit (1986), S. 25; <strong>der</strong>s., Was ma<strong>ch</strong>t eine Lebensform rational? (1988), S. 39. An<strong>der</strong>e Au-<br />
52


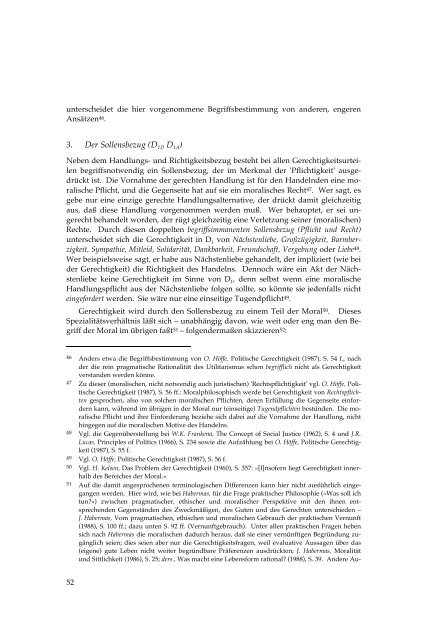



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









