Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eines Dramas, das ri<strong>ch</strong>tige und gere<strong>ch</strong>te Ents<strong>ch</strong>eidung symbolisiert« 48 , ohne sie tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
begründen zu müssen; es kennt we<strong>der</strong> normative no<strong>ch</strong> moralis<strong>ch</strong>e Aspekte<br />
49 . Mit Re<strong>ch</strong>t ist diese Position als »Verfahren statt Legitimation« 50 und »<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
ohne <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>« bezei<strong>ch</strong>net worden 51 . Als Rekonstruktion des Re<strong>ch</strong>tsfindungsprozesses<br />
stieß sie in <strong>der</strong> Jurisprudenz bisher dur<strong>ch</strong>weg auf Ablehnung 52 .<br />
Hier ist eine Bewertung entbehrli<strong>ch</strong>. Es genügt die Feststellung, daß Luhmanns systemtheoretis<strong>ch</strong>es<br />
Verfahrensmodell einen an<strong>der</strong>en Legitimitätsbegriff als die normativen<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien verwendet 53 und insgesamt Ausdruck eines grundlegenden<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sskeptizismus ist und insoweit <strong>der</strong> nietzs<strong>ch</strong>eanis<strong>ch</strong>en Grundposition<br />
zugere<strong>ch</strong>net werden kann. Dieser <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sskeptizismus ist ni<strong>ch</strong>t für jede<br />
Systemtheorie des Re<strong>ch</strong>ts zwingend 54 , prägt aber jedenfalls die Theorie Luhmanns.<br />
V. Theorie <strong>der</strong> Postmo<strong>der</strong>ne (K.-H. Ladeur)<br />
Die postmo<strong>der</strong>nen Gegenentwürfe zum Projekt <strong>der</strong> Aufklärung sind so vielfältig,<br />
daß si<strong>ch</strong> eine gemeinsame Charakterisierung weitgehend verbietet. Verbunden werden<br />
die <strong>Theorien</strong> aber dur<strong>ch</strong> eine allgemeine Vernunftskepsis 55 . Zur Illustration <strong>der</strong><br />
Vernunft- und <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sskepsis kann hier die postmo<strong>der</strong>ne Re<strong>ch</strong>tstheorie dienen,<br />
die Ladeur auf <strong>der</strong> Grundlage facettenrei<strong>ch</strong>er postmo<strong>der</strong>ner und poststrukturalistis<strong>ch</strong>er<br />
Kritiken (J. Derrida 56 , J.-F. Lyotard 57 , P. Ricœur 58 ) in Anlehnung an autopoie-<br />
48 N. Luhmann, Legitimation dur<strong>ch</strong> Verfahren (1969), S. 124; gegen die Sinnhaftigkeit einer sol<strong>ch</strong>en<br />
»symbolis<strong>ch</strong>en« Funktion des Verfahrens, in <strong>der</strong> Ri<strong>ch</strong>tigkeits- und <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sansprü<strong>ch</strong>e aufgegeben<br />
werden G. Zimmer, Funktion – Kompetenz – Legitimation (1979), S. 259 mit Fn. 42.<br />
49 Vgl. die Kritik bei J. S<strong>ch</strong>aper, Studien zur Theorie und Soziologie des geri<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Verfahrens<br />
(1985), S. 226 f.<br />
50 J. Heidorn, Legitimität und Regierbarkeit (1982), S. 118.<br />
51 O. Höffe, Politis<strong>ch</strong>e <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1987), S. 183.<br />
52 Vor allem bei J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl (1970), S. 201 ff. (207: »peinli<strong>ch</strong>e Verzerrung<br />
<strong>der</strong> Wirkli<strong>ch</strong>keit«), aber etwa au<strong>ch</strong> bei R. Zippelius, Legitimation im demokratis<strong>ch</strong>en Verfassungsstaat<br />
(1981), S. 87 ff.; <strong>der</strong>s., Re<strong>ch</strong>t und <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> in <strong>der</strong> offenen Gesells<strong>ch</strong>aft (1996), S. 87<br />
ff.; R. Dreier, Zu Luhmanns systemtheoretis<strong>ch</strong>er Neuformulierung des <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sproblems<br />
(1974), S. 194 ff. (aus Si<strong>ch</strong>t <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tstheorie).<br />
53 Vgl. R. Zippelius, Legitimation im demokratis<strong>ch</strong>en Verfassungsstaat (1981), S. 84 ff. (87) – Unters<strong>ch</strong>eidung<br />
<strong>der</strong> 'Legitimation' und 'Legitimität' in den normativen Wissens<strong>ch</strong>aften von <strong>der</strong>jenigen<br />
in <strong>der</strong> Soziologie.<br />
54 Z.B. vertritt G. Teubner, Re<strong>ch</strong>t als autopoietis<strong>ch</strong>es System (1989) eine systemtheoretis<strong>ch</strong>e Position,<br />
die ni<strong>ch</strong>t glei<strong>ch</strong>ermaßen gere<strong>ch</strong>tigkeitsskeptis<strong>ch</strong> ist wie diejenige Luhmanns; vgl. G. Teubner, Alter<br />
Pars Audiatur (1996), S. 218: »Eine Re<strong>ch</strong>tsordnung stellt si<strong>ch</strong> in dem Ausmaße <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>, als sie ni<strong>ch</strong>t nur die interne Konsistenz des Re<strong>ch</strong>ts erwirkli<strong>ch</strong>te, son<strong>der</strong>n<br />
zuglei<strong>ch</strong> die Eigenrationalität <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en beteiligten Diskurse re<strong>ch</strong>tsintern adäquat zu rekonstruieren<br />
versu<strong>ch</strong>te.«<br />
55 W. Reese-S<strong>ch</strong>äfer, Grenzgötter <strong>der</strong> Moral (1997), S. 41 – postmo<strong>der</strong>ne <strong>Theorien</strong> als »Feld von letztli<strong>ch</strong><br />
irrationalistis<strong>ch</strong>en Ethikbegründungen«; vgl. außerdem <strong>der</strong>s., Was bleibt na<strong>ch</strong> <strong>der</strong> Dekonstruktion?<br />
(1998), S. 143 f., 157 ff. Zur Kontingenz aller <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>skonzeptionen etwa R. Rorty,<br />
Kontingenz, Ironie und Solidarität (1989), S. 12 ff.<br />
56 Vgl. etwa J. Derrida, Force de loi (1990), S. 971 – <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> sei selbst für die, die an sie glauben,<br />
ni<strong>ch</strong>t erkennbar; S. 947 – <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als eine Erfahrung, die ni<strong>ch</strong>t erfahrbar sei. Vgl. dazu<br />
S.K. White, Political Theory and Postmo<strong>der</strong>nism (1991), S. 115 f.<br />
150


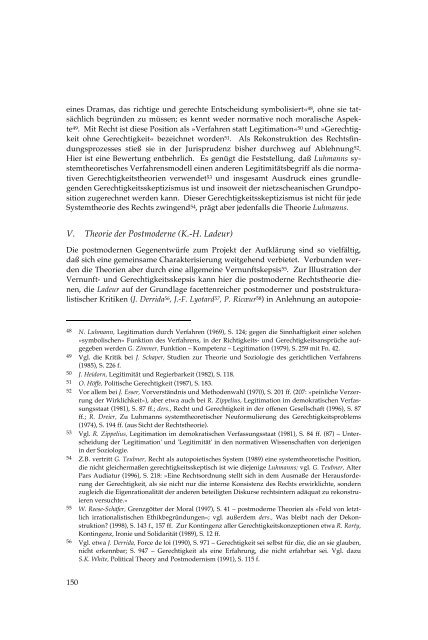



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









