Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
keit von Normen. Dabei kommen grundsätzli<strong>ch</strong> reale und ideale Diskurse in Betra<strong>ch</strong>t<br />
192 . S<strong>ch</strong>on Habermas Aussage, daß die ersten drei Grundre<strong>ch</strong>tsgruppen begründet<br />
seien, bevor es zu einer Autorenstellung <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tssubjekte komme, ma<strong>ch</strong>t<br />
deutli<strong>ch</strong>, daß er bezügli<strong>ch</strong> dieser Re<strong>ch</strong>te keine realen Diskurse als Grundlage <strong>der</strong><br />
Normbegründung ansieht. Vor allem aber läßt si<strong>ch</strong> die Ri<strong>ch</strong>tigkeit von Normen definitiv<br />
nur in idealen Diskursen begründen. Wenn Habermas argumentiert, die Grundre<strong>ch</strong>tsgruppen<br />
gehörten zu denjenigen Re<strong>ch</strong>ten, »die Bürger einan<strong>der</strong> zuerkennen<br />
müssen, wenn sie ihr Zusammenleben ... legitim regeln wollen« 193 , so klingt das na<strong>ch</strong><br />
einer Legitimität, die dur<strong>ch</strong> ideale Diskurse definitiv begründbar ist 194 .<br />
Damit bleiben für eine Begründung <strong>der</strong> ersten Grundre<strong>ch</strong>tsgruppen nur no<strong>ch</strong><br />
zwei Mögli<strong>ch</strong>keiten. Entwe<strong>der</strong> es wird postuliert, die Re<strong>ch</strong>te müßten das Ergebnis<br />
eines idealen Diskurses sein – Interpretation (2) – o<strong>der</strong> es ist ein transzendentales Argument<br />
gemeint – Interpretation (3) –, na<strong>ch</strong> dem die Grundre<strong>ch</strong>te <strong>der</strong> ersten drei<br />
Gruppen notwendig vorausgesetzt werden müssen, wenn man überhaupt Re<strong>ch</strong>te dur<strong>ch</strong><br />
ideale Diskurse begründen will. Es spri<strong>ch</strong>t einiges dafür, daß si<strong>ch</strong> für einzelne Re<strong>ch</strong>te<br />
zeigen läßt, daß sie notwendiges Ergebnis eines idealen Diskurses sein müssen 195 ;<br />
bei Habermas fehlt indes eine sol<strong>ch</strong>e Begründung. Au<strong>ch</strong> ein transzendentales Argument,<br />
na<strong>ch</strong> dem in <strong>der</strong> Anerkennung des Diskursprinzips bestimmte Grundre<strong>ch</strong>te<br />
notwendig vorausgesetzt sind, läßt si<strong>ch</strong> vortragen 196 . Es kann aber ni<strong>ch</strong>t einfa<strong>ch</strong> davon<br />
ausgegangen werden, daß Diskurse die Geltung universeller Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te notwendig<br />
voraussetzen 197 . Für eine vollständige Begründung muß vielmehr <strong>der</strong> S<strong>ch</strong>ritt<br />
von <strong>der</strong> Anerkennung <strong>der</strong> Freiheiten im idealen Diskurs hin zur Anerkennung <strong>der</strong><br />
Freiheiten im realen Handeln gelingen, für den bei Habermas bisher Argumente fehlen<br />
198 . Letztli<strong>ch</strong> weist seine Theorie bei <strong>der</strong> Übertragung des Diskursprinzips auf das<br />
Re<strong>ch</strong>t – glei<strong>ch</strong> wel<strong>ch</strong>e Interpretation man ihr geben mag – eine Begründungslücke<br />
auf 199 . Au<strong>ch</strong> gegenüber an<strong>der</strong>en, meist an Apel und Habermas orienterten Versu<strong>ch</strong>en<br />
einer diskurtheoretis<strong>ch</strong>en Begründung <strong>der</strong> Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te läßt si<strong>ch</strong> diese Begründungslücke<br />
aufzeigen 200 . Ihr Gewi<strong>ch</strong>t wird ni<strong>ch</strong>t dadur<strong>ch</strong> geringer, daß heute eine<br />
192 Vgl. oben S. 220 ff. (ideale und reale Diskurse). Diese Zweigleisigkeit <strong>der</strong> diskursiven Normbegründung<br />
findet si<strong>ch</strong> in an<strong>der</strong>em Zusammenhang au<strong>ch</strong> bei J. Habermas, Faktizität und Geltung<br />
(1992), S. 47 f.: »Hingegen bemißt si<strong>ch</strong> die Legitimität von Regeln ... letztli<strong>ch</strong> daran, ob sie in einem<br />
rationalen Gesetzgebungsverfahren zustandegekommen sind – o<strong>der</strong> wenigstens unter pragmatis<strong>ch</strong>en,<br />
ethis<strong>ch</strong>en und moralis<strong>ch</strong>en Gesi<strong>ch</strong>tspunkten hätten gere<strong>ch</strong>tfertigt werden können.« (Hervorhebung<br />
bei Habermas).<br />
193 J. Habermas, Faktizität und Geltung (1992), S. 155.<br />
194 An<strong>der</strong>s begründet, nämli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> reale Diskurse, sind bei Habermas die Normen, die si<strong>ch</strong> aus dem<br />
demokratis<strong>ch</strong>en Prozeß ergeben; vgl. oben S. 242 ff. (deliberative Politik).<br />
195 Dazu unten S. 326 ff. (diskursiv notwendige <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>snormen).<br />
196 Dazu oben S. 250 ff. (Alexys Begründung <strong>der</strong> Freiheit) sowie unten S. 321 ff. (diskurstheoretis<strong>ch</strong><br />
notwendige <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>snormen).<br />
197 Ähnli<strong>ch</strong> E. Zimmermann, Multideontis<strong>ch</strong>e Logik und <strong>Prozedurale</strong> Re<strong>ch</strong>tstheorie II (1999), S. 273 ff.<br />
– aus den Diskursregeln allein folgen keine normativen Prinzipien für den Berei<strong>ch</strong> des Handelns.<br />
198 Ähnli<strong>ch</strong> K.T. S<strong>ch</strong>uon, Von <strong>der</strong> Diskursethik zur <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie (1990), S. 43 – Lücke zwis<strong>ch</strong>en<br />
Grundprinzipien <strong>der</strong> Diskursethik und einer politis<strong>ch</strong>en Theorie.<br />
199 Daran än<strong>der</strong>t au<strong>ch</strong> die jüngere Argumentation ni<strong>ch</strong>ts; vgl. J. Habermas, Faktizität und Geltung<br />
(1994), S. 670 ff.<br />
200 Das gilt beispielsweise gegenüber <strong>der</strong> Argumentation von E. Arens, Der Beitrag <strong>der</strong> Diskursethik<br />
zur universalen Begründung <strong>der</strong> Mens<strong>ch</strong>enre<strong>ch</strong>te (1991), S. 69 f. zu erheben. Dort heißt es: »Zu-<br />
298


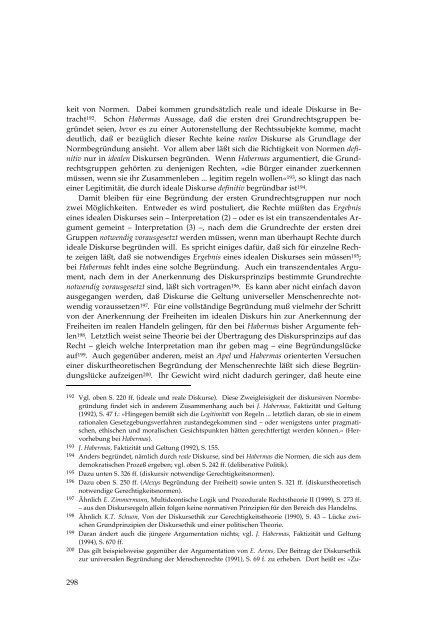



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









