Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
men, weniger geeignet sind, gute Gründe zu identifizieren. Dies indes kann mit folgen<strong>der</strong><br />
Argumentation belegt werden.<br />
Bei praktis<strong>ch</strong>en Fragen ist die persönli<strong>ch</strong>e Voreingenommenheit in aller Regel<br />
größer als bei sol<strong>ch</strong>en über beweisbare Tatsa<strong>ch</strong>en. Wer über Handeln urteilt, tut dies<br />
immer vor dem Hintergrund <strong>der</strong> eigenen vergangenen und geplanten zukünftigen<br />
Aktivität – er ist befangen. Bezogen auf beweisbare Tatsa<strong>ch</strong>en wird si<strong>ch</strong> eine sol<strong>ch</strong>e<br />
Befangenheit nur selten einstellen. Damit kommt in Fragen des Handelns <strong>der</strong> Herstellung<br />
von Unparteili<strong>ch</strong>keit eine größere Bedeutung zu. Es ist folgli<strong>ch</strong> unter vers<strong>ch</strong>iedenen<br />
Konzeptionen <strong>der</strong> praktis<strong>ch</strong>en Vernunft diejenige vorzugswürdig, bei<br />
<strong>der</strong> eher zu erwarten ist, daß sie die Unparteili<strong>ch</strong>keit tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> herstellen kann.<br />
Während dialogis<strong>ch</strong>e Konzeptionen dies dur<strong>ch</strong> eine Mehrzahl von frei und glei<strong>ch</strong><br />
agierenden Teilnehmern garantieren, sind monologis<strong>ch</strong>e Konzeptionen auf die innere<br />
Distanzierung von persönli<strong>ch</strong>en Interessen und Meinungen angewiesen. In hypothetis<strong>ch</strong>en<br />
Idealsituationen mag die innere Distanzierung (Binnenpluralismus) glei<strong>ch</strong><br />
gut gelingen wie die äußere Pluralität <strong>der</strong> Ansi<strong>ch</strong>ten. Bei einer Übertragung auf reale<br />
Situationen des praktis<strong>ch</strong>en Vernunftgebrau<strong>ch</strong>s wird dagegen in aller Regel eine<br />
äußere Meinungsvielfalt einfa<strong>ch</strong>er und umfassen<strong>der</strong> herzustellen sein als die psy<strong>ch</strong>ologis<strong>ch</strong><br />
anspru<strong>ch</strong>svolle, tendenziell s<strong>ch</strong>wer kontrollierbare und kaum jemals umfassende<br />
innere Distanzierung von eigenen Überzeugungen. Monologis<strong>ch</strong>e Konzeptionen<br />
<strong>der</strong> praktis<strong>ch</strong>en Vernunft stoßen dadur<strong>ch</strong> auf zusätzli<strong>ch</strong>e Probleme 138 , dialogis<strong>ch</strong>e<br />
Konzeptionen haben zumindest einen heuristis<strong>ch</strong>en Vorteil 139 . Abgesehen von<br />
einigen Son<strong>der</strong>situationen, in denen (friedli<strong>ch</strong>e) Pluralität <strong>der</strong> Meinungen unter vers<strong>ch</strong>iedenen<br />
Personen s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>terdings ni<strong>ch</strong>t herzustellen ist, sollten deshalb dialogis<strong>ch</strong>e<br />
Konzeptionen <strong>der</strong> praktis<strong>ch</strong>en Vernunft den monologis<strong>ch</strong>en vorgezogen werden.<br />
Dur<strong>ch</strong> die Einbindung <strong>der</strong> Argumente in eine kommunikative – d.h. ni<strong>ch</strong>t bloß<br />
monologis<strong>ch</strong>e – Struktur kann das größtmögli<strong>ch</strong>e Maß an Rationalität realisiert werden<br />
140 .<br />
III. Zur Kritik <strong>der</strong> Diskurstheorien<br />
Am diskurstheoretis<strong>ch</strong>en Ansatz ist vielfältige Kritik geübt worden 141 , die in allen ihren<br />
Facetten und in den unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>en Ansatzpunkten zu ihrer Wi<strong>der</strong>legung 142<br />
138 Vgl. R. Alexy, Theorie <strong>der</strong> juristis<strong>ch</strong>en Argumentation (1978), S. 224 mit Fn. 11 – zusätzli<strong>ch</strong>e Probleme<br />
müßten au<strong>ch</strong> bei einer Theorie des 'inneren Diskurses' gelöst werden.<br />
139 Das ist selbst bei diskurskritis<strong>ch</strong>er Betra<strong>ch</strong>tung zuzugestehen: H. Koriath, Diskurs und Strafre<strong>ch</strong>t<br />
(1999), S. 193: »Der Diskurs ist ein heuristis<strong>ch</strong>es Mittel, Begründungen enthält er ni<strong>ch</strong>t.«<br />
140 R. Alexy, Theorie <strong>der</strong> juristis<strong>ch</strong>en Argumentation (1991), S. 409.<br />
141 Etwa bei E. Tugendhat, Probleme <strong>der</strong> Ethik (1984), S. 108 ff. (monologis<strong>ch</strong>es statt dialogis<strong>ch</strong>es Rationalitätskonzept);<br />
A. Kaufmann, <strong>Prozedurale</strong> <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. 17 ff. (Inhaltsleere);<br />
<strong>der</strong>s., Über <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1993), S. 301 ff., 320 (Rangordnung <strong>der</strong> Argumente); H. Keuth, Erkenntnis<br />
o<strong>der</strong> Ents<strong>ch</strong>eidung (1993), S. 203 ff., 347 ff. (Beliebigkeit <strong>der</strong> Begründung); O. Weinberger,<br />
Conflicting Views on Practical Rationality (1992), S. 256 ff. (260) (Konsens als 'Pseudo-Argument');<br />
<strong>der</strong>s., Über die Kultur <strong>der</strong> politis<strong>ch</strong>en Argumentation (1994), S. 150; <strong>der</strong>s., Habermas on Democracy<br />
and Justice (1994), S. 242 (Konvergenzbeweis); <strong>der</strong>s., Diskursive Demokratie ohne Diskursphilosophie<br />
(1996), S. 428 ff. (Diskurs als 's<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te Idealisierung'); U. Steinhoff, Probleme <strong>der</strong> Legitimation<br />
(1996), S. 449 ff.<br />
290


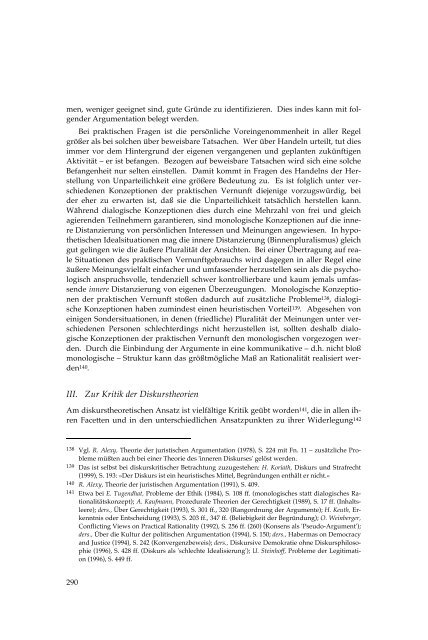



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









