Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
immer eine Dankesfeier veranstaltet wird. Die Ni<strong>ch</strong>tveranstaltung <strong>der</strong> Feier trifft<br />
dann alle drei als Ungere<strong>ch</strong>tigkeit, weil es eine Sozialregel gibt, na<strong>ch</strong> <strong>der</strong> ihnen eine<br />
Belohnung zusteht. Allgemein gilt dana<strong>ch</strong>: Wenn ein Verteilungs- o<strong>der</strong> Ausglei<strong>ch</strong>sprinzip<br />
hinzugezogen wird, dessen Anwendung eine Handlung for<strong>der</strong>t, dann begründet<br />
das Zuwi<strong>der</strong>handeln bezogen auf die glei<strong>ch</strong>mäßige Verwirkli<strong>ch</strong>ung des<br />
Prinzips eine Unglei<strong>ch</strong>behandlung und damit (umgangsspra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>) eine Ungere<strong>ch</strong>tigkeit.<br />
d) Zur Kritik am Glei<strong>ch</strong>heitsbezug<br />
Trotz <strong>der</strong> breiten Akzeptanz eines auf Glei<strong>ch</strong>heit bezogenen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffs<br />
ist die Einbeziehung des Glei<strong>ch</strong>heitskriteriums in die Begriffsbestimmung von D 1<br />
problematis<strong>ch</strong>. Die auf Aristoteles zurückgehende Identifikation von <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
und Glei<strong>ch</strong>heit ist mit einiger Bere<strong>ch</strong>tigung als eine unbegründete Bes<strong>ch</strong>ränkung kritisiert<br />
worden 84 . Denn die Annahme eines begriffli<strong>ch</strong> notwendigen Glei<strong>ch</strong>heitsbezugs<br />
läuft Gefahr, wi<strong>ch</strong>tige Aspekte des <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffs in <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien<br />
auszublenden. Identifiziert man nämli<strong>ch</strong> die Su<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> im Re<strong>ch</strong>t<br />
mit <strong>der</strong> Su<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> Kriterien für ri<strong>ch</strong>tiges Re<strong>ch</strong>t 85 , so kann diese Su<strong>ch</strong>e ni<strong>ch</strong>t bei<br />
glei<strong>ch</strong>heitsbezogenen Kriterien verharren. Sonst müßte <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> s<strong>ch</strong>on immer<br />
dann angenommen werden, wenn alle Betroffenen ausnahmslos glei<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t behandelt<br />
werden – eine (vorsi<strong>ch</strong>tig ausgedrückt) »mißli<strong>ch</strong>e Konsequenz« 86 .<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien müssen, da sie au<strong>ch</strong> eine glei<strong>ch</strong>mäßig s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te Behandlung<br />
aller Betroffenen in bestimmten Fällen als 'ungere<strong>ch</strong>t' beurteilen, mit einem weiten<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriff operieren. Dieser weite Begriff <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> läßt si<strong>ch</strong><br />
sowohl in <strong>der</strong> politis<strong>ch</strong>en Philosophie als au<strong>ch</strong> in <strong>der</strong> Re<strong>ch</strong>tstheorie neben an<strong>der</strong>en,<br />
engeren <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffen (Einzelfallgere<strong>ch</strong>tigkeit 87 , Fairneß 88 ) na<strong>ch</strong>weisen 89 .<br />
Er identifiziert <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> mit Ri<strong>ch</strong>tigkeit s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>thin, also ni<strong>ch</strong>t bloß mit glei<strong>ch</strong>-<br />
84 J.R. Lucas, Principles of Politics (1966), S. 242: »Justice itself is not Equality. Aristotle, at the cost of<br />
great artificiality, made out that it was, and has been too mu<strong>ch</strong> quoted and too little criticized.«<br />
Kritis<strong>ch</strong> zum Glei<strong>ch</strong>heitskriterium au<strong>ch</strong> I. Tammelo, Theorie <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1977), S. 76 f.: »Es<br />
gibt indessen s<strong>ch</strong>werwiegende Bedenken gegen die Wahl von 'Glei<strong>ch</strong>heit' als Wesensmerkmal des<br />
Begriffes 'gere<strong>ch</strong>t'«; ähnli<strong>ch</strong>: <strong>der</strong>s., Re<strong>ch</strong>tslogik und materiale <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1971), S. 58 ff.; S. Huster,<br />
Re<strong>ch</strong>te und Ziele (1993), S. 222.<br />
85 Dazu oben Fn. 28 (<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> des Re<strong>ch</strong>ts glei<strong>ch</strong>bedeutend mit 'ri<strong>ch</strong>tigem Re<strong>ch</strong>t').<br />
86 S. Huster, Re<strong>ch</strong>te und Ziele (1993), S. 222.<br />
87 Dazu unten S. 63 (engere <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffe).<br />
88 Dazu unten S. 121 (Begriff <strong>der</strong> Fairneß). Zur Di<strong>ch</strong>otomie einer <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als Fairneß und einer<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> in einem umfassen<strong>der</strong>en Sinne vgl. etwa: N. Res<strong>ch</strong>er, Distributive Justice (1966),<br />
S. 90: »There is justice in the narrower sense of fairness, on the one hand, and on the other, justice in a<br />
wi<strong>der</strong> sense, taking account of the general good.« (Hervorhebungen bei Res<strong>ch</strong>er).<br />
89 Für einen weiten <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriff etwa M. Rümelin, Die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1920), S. 50; W.K.<br />
Frankena, The Concept of Social Justice (1962), S. 3 ff. (10); A. Gewirth, Political Justice (1962),<br />
S. 125; B. Rüthers, Warum wir ni<strong>ch</strong>t genau wissen, was '<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>' ist (1987), S. 19 ff. (22 f.:<br />
Re<strong>ch</strong>tssi<strong>ch</strong>erheit als eines unter mehreren Merkmalen <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>); <strong>der</strong>s., Das Ungere<strong>ch</strong>te an<br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1991), S. 17 ff.; R. Zippelius, Re<strong>ch</strong>tsphilosophie (1989), S. 75 ff., 106 ff.; W. Wels<strong>ch</strong>,<br />
Vernunft (1995), S. 698 ff., 707 f. Zum Unters<strong>ch</strong>ied zwis<strong>ch</strong>en engem und weitem Begriff außerdem<br />
W. Fikents<strong>ch</strong>er, Methoden des Re<strong>ch</strong>ts IV (1977), S. 188 ff. ('Sa<strong>ch</strong>gere<strong>ch</strong>tigkeit' neben 'Glei<strong>ch</strong>gere<strong>ch</strong>tigkeit');<br />
S. Huster, Re<strong>ch</strong>te und Ziele (1993), S. 195 ff.<br />
60


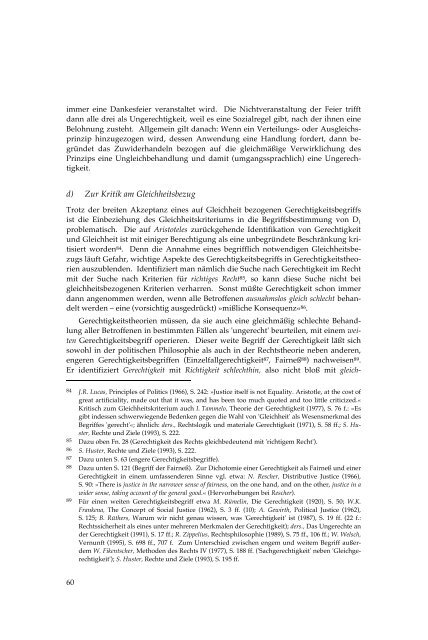



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









