Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
D 1D :<br />
D 1A :<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> im deontologis<strong>ch</strong>en Sinn ist die Ri<strong>ch</strong>tigkeit<br />
und Pfli<strong>ch</strong>tigkeit eines Handelns in bezug auf an<strong>der</strong>e<br />
unter dem Gesi<strong>ch</strong>tspunkt <strong>der</strong> Glei<strong>ch</strong>heit.<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> im axiologis<strong>ch</strong>en Sinn ist die Ri<strong>ch</strong>tigkeit<br />
und Werthaftigkeit eines Handelns in bezug auf an<strong>der</strong>e<br />
unter dem Gesi<strong>ch</strong>tspunkt <strong>der</strong> Glei<strong>ch</strong>heit.<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> wird na<strong>ch</strong> D 1D und D 1A unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong> begründet. Wer beispielsweise<br />
begründen will, daß es gere<strong>ch</strong>t ist, allen Kin<strong>der</strong>n glei<strong>ch</strong> viel zu s<strong>ch</strong>enken, würde das<br />
deontologis<strong>ch</strong> dadur<strong>ch</strong> erklären, daß die Handlungsweise aus si<strong>ch</strong> selbst heraus ri<strong>ch</strong>tig<br />
und pfli<strong>ch</strong>tig ist. Axiologis<strong>ch</strong> wäre die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> <strong>der</strong> Handlungsweise damit<br />
zu erklären, daß das Ergebnis einer glei<strong>ch</strong>en Ges<strong>ch</strong>enkverteilung 'gut' und die Handlung<br />
um dieses Zieles willen (teleologis<strong>ch</strong>) wertvoll ist. Grundsätzli<strong>ch</strong> impliziert eine<br />
<strong>der</strong>artige Werthaftigkeit no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t, daß etwas au<strong>ch</strong> gesollt ist, denn es ist ein Unters<strong>ch</strong>ied,<br />
ob etwas als 'gut' bezei<strong>ch</strong>net wird, o<strong>der</strong> ob es außerdem als 'geboten', 'verboten'<br />
o<strong>der</strong> 'erlaubt' gilt – axiologis<strong>ch</strong>e Sätze bedingen deontologis<strong>ch</strong>e Aussagen<br />
grundsätzli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t 62 . Beim <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriff ist das an<strong>der</strong>s. Wer sagt, ein Handeln<br />
sei so wertvoll, daß ohne dieses Handeln keine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> mehr bestünde,<br />
<strong>der</strong> sagt damit implizit, daß das Handeln au<strong>ch</strong> gefor<strong>der</strong>t ist 63 . Der Sollensbezug ist<br />
ein begriffsnotwendiger Teil <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>. Ein axiologis<strong>ch</strong>es Verständnis <strong>der</strong><br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> bietet darum keine vollständige Bes<strong>ch</strong>reibung des <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffs.<br />
D 1A wird deshalb im folgenden ni<strong>ch</strong>t verwendet.<br />
4. Der Sozialbezug<br />
Alle <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>surteile weisen ferner einen Sozialbezug auf, da <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> nur<br />
Handeln betrifft, das si<strong>ch</strong> auf an<strong>der</strong>e Personen ri<strong>ch</strong>tet 64 . Was <strong>der</strong> Eremit in <strong>der</strong> Wüste<br />
o<strong>der</strong> ein S<strong>ch</strong>iffbrü<strong>ch</strong>iger auf <strong>der</strong> Insel für si<strong>ch</strong> selbst als Handlungsnorm gelten<br />
lassen, ist zwar Teil ihrer jeweiligen Individualmoral, wirft aber keine Fragen <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
auf. Ni<strong>ch</strong>t jede moralis<strong>ch</strong>e Frage ist glei<strong>ch</strong>zeitig eine Frage <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
65 . So berührt beispielsweise ein Suizid in <strong>der</strong> Privatsphäre moralis<strong>ch</strong>e Fragen,<br />
62 Vgl. R. Alexy, Theorie <strong>der</strong> juristis<strong>ch</strong>en Argumentation (1978), S. 221: »die in normativen Aussagen<br />
(Wert- und Verpfli<strong>ch</strong>tungsurteilen) vorkommenden normativen Ausdrücke wie ‚gut' o<strong>der</strong> ‚gesollt'«.<br />
Die Werthaftigkeit impliziert grundsätzli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t die Pfli<strong>ch</strong>tigkeit. Nur umgekehrt gilt die<br />
Regel: die Pfli<strong>ch</strong>tigkeit impliziert die Werthaftigkeit – deontologis<strong>ch</strong>e Sätze konstituieren axiologis<strong>ch</strong>e<br />
Aussagen; vgl. H. Kelsen, Reine Re<strong>ch</strong>tslehre (1960), S. 16 ff. (17): »Eine objektiv gültige<br />
Norm, die ein bestimmtes Verhalten als gesollt setzt, konstituiert einen positiven o<strong>der</strong> negativen<br />
Wert.« So erklärt si<strong>ch</strong> die Aussage, daß »<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>surteile letztli<strong>ch</strong> Werturteile seien«,<br />
M. Kriele, Kriterien <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1963), S. 30.<br />
63 So im Ergebnis au<strong>ch</strong> N. Jansen, Struktur <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1998), S. 61 ff.; bei <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als<br />
einem moralis<strong>ch</strong>en Wertprädikat gelte allerdings (ausnahmsweise) ein 'Brückenprinzip', na<strong>ch</strong><br />
dem alles, was als gere<strong>ch</strong>t bewertet werden kann au<strong>ch</strong> als pfli<strong>ch</strong>tig geboten ist.<br />
64 G. Del Vec<strong>ch</strong>io, Die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1950), S. 2, 45; H. Kelsen, Das Problem <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1960),<br />
S. 357; W. Brugger, Gesetz, Re<strong>ch</strong>t, <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. 5; M. Fisk, Justice and Universality<br />
(1995), S. 225 ff.<br />
65 J.R. Lucas, Principles of Politics (1966), S. 233.<br />
55


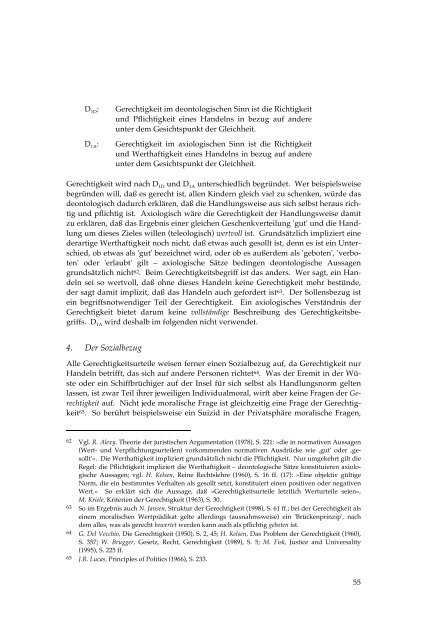



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









