Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
net also die Situation, in <strong>der</strong> P und T ständig gegeneinan<strong>der</strong> anspielen (Drohspielbedingung).<br />
Nun ist aber Pianist P empfindli<strong>ch</strong>er gegenüber dem glei<strong>ch</strong>zeitigen<br />
Spielen. Die gegenseitige Drohung belastet P folgli<strong>ch</strong> stärker als T. Entspre<strong>ch</strong>end<br />
hat P einen größeren Nutzen von je<strong>der</strong> wie au<strong>ch</strong> immer gearteten Kooperation. Relativ<br />
zum dur<strong>ch</strong> Drohung gekennzei<strong>ch</strong>neten Ni<strong>ch</strong>teinigungspunkt muß eine Glei<strong>ch</strong>verteilung<br />
<strong>der</strong> Nutzengewinne also in einer Unglei<strong>ch</strong>verteilung <strong>der</strong> Spielzeiten resultieren.<br />
Ohne daß es hier auf eine genaue Beispielre<strong>ch</strong>nung ankäme 226 , wäre P soviel<br />
weniger Spielzeit als T einzuräumen, daß beide den glei<strong>ch</strong>en Nutzengewinn aus <strong>der</strong><br />
Gesamtkooperation ziehen. Gere<strong>ch</strong>t ist dana<strong>ch</strong> das Ergebnis, das deshalb Ausdruck<br />
einer rationalen Ents<strong>ch</strong>eidung ist, weil es den relativ zu einer Grundposition gegenseitiger<br />
S<strong>ch</strong>ädigungsdrohung (Drohspielbedingung) entstehenden Nutzengewinn<br />
glei<strong>ch</strong>mäßig auf die Parteien verteilt.<br />
2. Theorie <strong>der</strong> öffentli<strong>ch</strong>en Wahl (J.M. Bu<strong>ch</strong>anan)<br />
a) Das Ideal einer geordneten Anar<strong>ch</strong>ie<br />
Bu<strong>ch</strong>anan gilt als einer <strong>der</strong> ersten Theoretiker, <strong>der</strong> politis<strong>ch</strong>e Ents<strong>ch</strong>eidungsfindung<br />
na<strong>ch</strong> <strong>der</strong> neueren ökonomis<strong>ch</strong>en Theorie modelliert hat 227 . Die von ihm gemeinsam<br />
mit Tullock begründete Theorie <strong>der</strong> öffentli<strong>ch</strong>en Wahl (public <strong>ch</strong>oice theory 228 ) fragt dana<strong>ch</strong>,<br />
wel<strong>ch</strong>e politis<strong>ch</strong>e Ordnung entstehen müßte, wenn die Beteiligten in einer Art<br />
Marktordnung <strong>der</strong> Sozialmodelle auss<strong>ch</strong>ließli<strong>ch</strong> ihrem Eigeninteresse folgten 229 . Als<br />
Antwort präsentiert Bu<strong>ch</strong>anan eine Sozialvertragstheorie, in <strong>der</strong> ein Szenario maximaler<br />
Drohung zur Grundlage gema<strong>ch</strong>t wird 230 . Die stark am Effizienzdenken orientierte<br />
<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie kann im Spektrum <strong>der</strong> Sozialvertragstheorien als ökonomis<strong>ch</strong>e<br />
Konzeption bezei<strong>ch</strong>net werden. Sie geht davon aus, daß <strong>der</strong> ideale Sozialzustand<br />
in einer 'geordneten Anar<strong>ch</strong>ie' bestünde 231 . In <strong>der</strong> ungeordneten Anar<strong>ch</strong>ie als einem<br />
Zustand unbes<strong>ch</strong>ränkter Handlungsfreiheiten ergibt si<strong>ch</strong> die natürli<strong>ch</strong>e Güterverteilung<br />
daraus, daß si<strong>ch</strong> Grenznutzen und Grenzkosten für zusätzli<strong>ch</strong>en Aufwand die<br />
Waage halten. Diese natürli<strong>ch</strong>e Verteilung ist aber wegen <strong>der</strong> hohen Verteidigungskosten<br />
auf einem niedrigen Niveau angesiedelt. Denn im Naturzustand fehle es an<br />
226 Dazu R.B. Braithwaite, Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher (1955), S. 26 ff.<br />
227 Diese beson<strong>der</strong>e Bedeutung zeigt si<strong>ch</strong> darin, daß Bu<strong>ch</strong>anan im Jahre 1986 mit dem Nobelpreis für<br />
Ökonomie ausgezei<strong>ch</strong>net wurden; vgl. Königli<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>wedis<strong>ch</strong>e Akademie <strong>der</strong> Wissens<strong>ch</strong>aften,<br />
Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 1995, Pressemitteilung<br />
vom 16. Oktober 1986: James McGill Bu<strong>ch</strong>anan (Virginia, USA) »for his development of the contractual<br />
and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making.«<br />
228 J.M. Bu<strong>ch</strong>anan/G. Tullock, The Calculus of Consent (1962); G.J. Stigler, The Citizen and the State<br />
(1975); J.M. Bu<strong>ch</strong>anan, Limits of Liberty (1975). Die Theorie wird heute überwiegend dur<strong>ch</strong> Beiträge<br />
in <strong>der</strong> Zeits<strong>ch</strong>rift 'Public Choice' vorangetrieben.<br />
229 Vgl. B. Ackerman, We The People (1991), S. 308 ff. (311) – Charakterisierung und Kritik <strong>der</strong> public<br />
<strong>ch</strong>oice theory; C. Kir<strong>ch</strong>ner, Ökonomis<strong>ch</strong>e Theorie des Re<strong>ch</strong>ts (1997), S. 23 ff. – public <strong>ch</strong>oice als »Ökonomis<strong>ch</strong>e<br />
Theorie <strong>der</strong> Verfassung«.<br />
230 J.M. Bu<strong>ch</strong>anan, Limits of Liberty (1975), S. 60 ff.<br />
231 Zum Idealzustand einer 'geordneten Anar<strong>ch</strong>ie' und seiner Unmögli<strong>ch</strong>keit siehe J.M. Bu<strong>ch</strong>anan,<br />
Limits of Liberty (1975), S. 189.<br />
177


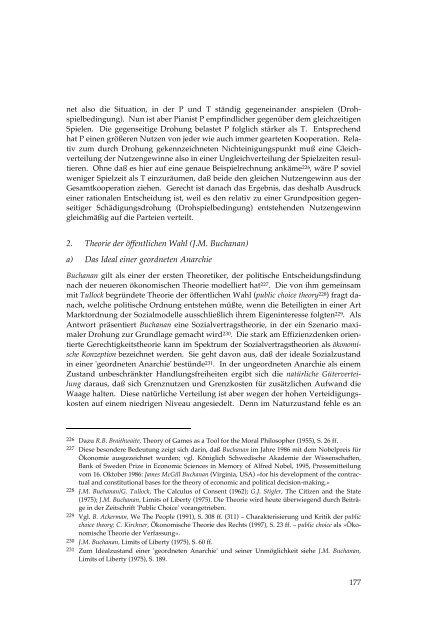



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









