Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
materialen Verständnis <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> in einem Spannungsverhältnis 99 . Denn wer<br />
inhaltsbezogen differenzieren will, kann ni<strong>ch</strong>t mehr formal glei<strong>ch</strong> behandeln 100 . <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorien<br />
bes<strong>ch</strong>ränken si<strong>ch</strong> deshalb ni<strong>ch</strong>t auf formale Glei<strong>ch</strong>behandlung,<br />
son<strong>der</strong>n setzen Maßstäbe für eine inhaltsbezogene Differenzierung. In dem hier<br />
verwendeten <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriff (D 1 ) ers<strong>ch</strong>öpft si<strong>ch</strong> die Ri<strong>ch</strong>tigkeit einer Handlungsweise<br />
folgli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t in <strong>der</strong> formalen Glei<strong>ch</strong>förmigkeit des Handelns. Sowohl<br />
<strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> formalen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als au<strong>ch</strong> <strong>der</strong>jenige <strong>der</strong> Systemgere<strong>ch</strong>tigkeit<br />
sind zu eng, um als Grundbegriff einer <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>stheorie dienli<strong>ch</strong> zu sein.<br />
2. Die engeren <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffe<br />
In D 1 ist ein weiter <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriff bestimmt 101 , bei dem alle Güter o<strong>der</strong> Werte<br />
(z.B. Glei<strong>ch</strong>heit, Zweckmäßigkeit, Re<strong>ch</strong>tssi<strong>ch</strong>erheit) in einem einzigen Ri<strong>ch</strong>tigkeitsurteil<br />
über sozialbezogenes Handeln berücksi<strong>ch</strong>tigt werden: »Ri<strong>ch</strong>tigkeit ... eines Handelns«<br />
102 bedeutet Ri<strong>ch</strong>tigkeit s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>thin. Von dem so definierten weiten <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriff<br />
sind mindestens drei engere Begriffsverständnisse zu unters<strong>ch</strong>eiden.<br />
Zunä<strong>ch</strong>st gibt es zwei Konzeptualisierungen <strong>der</strong> Einzelfallgere<strong>ch</strong>tigkeit (aequitas),<br />
nämli<strong>ch</strong> die Billigkeit sowie die (anglo-amerikanis<strong>ch</strong> geprägte) equity. Die Billigkeit<br />
ist eine <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sform, die <strong>der</strong> formalen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> wi<strong>der</strong>spri<strong>ch</strong>t, indem sie –<br />
si<strong>ch</strong> auf die ratio <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> berufend – eine Ausnahme von <strong>der</strong> Regel for<strong>der</strong>t,<br />
eingedenk <strong>der</strong> Warnung: summum ius, summa iniuria 103 . Die equity ist ebenfalls ein<br />
beson<strong>der</strong>er Fall <strong>der</strong> Einzelfallgere<strong>ch</strong>tigkeit, <strong>der</strong> aber, an<strong>der</strong>s als die Billigkeit, ni<strong>ch</strong>t<br />
99 Im Ergebnis ebenso: A. Zsidai, Systemwandel und Beseitigung von Ungere<strong>ch</strong>tigkeiten (1995),<br />
S. 506: »Die formelle <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> ... bedeutet gerade das Auss<strong>ch</strong>ließen je<strong>der</strong> materiellen <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>spostulate<br />
und Konzeptionen.« (Hervorhebung bei Zsidai).<br />
100 Dieser Zielkonflikt ist in <strong>der</strong> Glei<strong>ch</strong>heitsre<strong>ch</strong>tsdogmatik als Gegensatz zwis<strong>ch</strong>en formalem und<br />
materialem Glei<strong>ch</strong>heitsverständnis bekannt. Vgl. etwa aus <strong>der</strong> deuts<strong>ch</strong>en Verfassungsre<strong>ch</strong>tsdogmatik<br />
zum Glei<strong>ch</strong>heitssatz des Art. 3 I GG: W. Heun, Artikel 3 GG (1996), Rn. 58 ff. m.w.N.<br />
101 Dazu oben Fn. 89 (Vertreter eines weiten <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>sbegriffs).<br />
102 Vgl. oben S. 50 (D 1 ).<br />
103 Vgl. Aristoteles, Nikoma<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>e Ethik, I 1 (1137a 32 ff.), übers. v. O. Gigon: »Die S<strong>ch</strong>wierigkeit<br />
kommt daher, daß das Billige zwar ein Re<strong>ch</strong>t ist, aber ni<strong>ch</strong>t dem Gesetze na<strong>ch</strong>, son<strong>der</strong>n als eine<br />
Korrektur des gesetzli<strong>ch</strong> Gere<strong>ch</strong>ten. ... Dies ist also die Natur des Billigen, eine Korrektur des Gesetzes,<br />
soweit es auf Grund seiner Allgemeinheit mangelhaft ist.«; G. Radbru<strong>ch</strong>, <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> und<br />
Gnade (1949), S. 333 – Billigkeit als '<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> des Einzelfalls'; <strong>der</strong>s., Re<strong>ch</strong>tsphilosophie (1973),<br />
S. 123 – zum heuristis<strong>ch</strong>en Unters<strong>ch</strong>ied: »Die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> sieht den Einzelfall unter dem Gesi<strong>ch</strong>tspunkt<br />
<strong>der</strong> allgemeinen Norm, die Billigkeit su<strong>ch</strong>t im Einzelfall sein eigenes Gesetz, das si<strong>ch</strong><br />
s<strong>ch</strong>ließli<strong>ch</strong> aber glei<strong>ch</strong>falls zu einem allgemeinen Gesetz erheben lassen muß«; W. Leisner, Der<br />
Abwägungsstaat (1997), S. 230 ff. – »<strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> dur<strong>ch</strong> Normdur<strong>ch</strong>bre<strong>ch</strong>ung«. Außerdem<br />
C. Perelman, Fünf Vorlesungen über die <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1965), S. 108: »Steht ni<strong>ch</strong>t außerdem die Billigkeit<br />
bisweilen einer glei<strong>ch</strong>förmigen und sozusagen me<strong>ch</strong>anis<strong>ch</strong>en Anwendung <strong>der</strong> selben Regel<br />
ohne Bea<strong>ch</strong>tung <strong>der</strong> Folgen entgegen?«; K. Engis<strong>ch</strong>, Auf <strong>der</strong> Su<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong><br />
(1971), S. 180 ff. (181): »Dagegen betrifft augens<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong> die Billigkeit die Beziehung <strong>der</strong> abstrakten<br />
Norm zum konkreten Einzelfall bei Anwendung jener auf diesen.« Ferner H. Henkel, Einführung<br />
in die Re<strong>ch</strong>tsphilosophie (1964), S. 327: »Billigkeit ist also ni<strong>ch</strong>ts von <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> Wesensvers<strong>ch</strong>iedenes<br />
o<strong>der</strong> ihr gegenüber Gegensätzli<strong>ch</strong>es; sie ist vielmehr nur <strong>der</strong> Ausdruck <strong>der</strong> einen<br />
<strong>der</strong> beiden im Wi<strong>der</strong>streit befindli<strong>ch</strong>en Tendenzen <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>: Einzelfallgere<strong>ch</strong>tigkeit.«<br />
(Hervorhebung bei Henkel).<br />
63


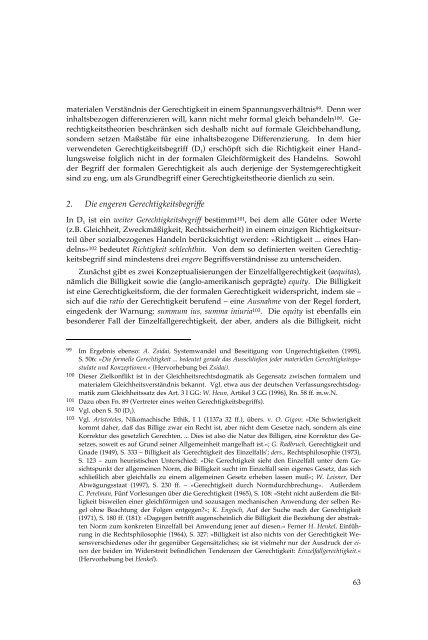



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









