Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit - servat.unibe.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ationalität bezei<strong>ch</strong>net das selbstlegitimierende Glei<strong>ch</strong>gewi<strong>ch</strong>t, das si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> den Interessenabglei<strong>ch</strong><br />
vers<strong>ch</strong>iedener Vertragsparteien in einer Verhandlung einstellt, das<br />
dur<strong>ch</strong> die Zustimmung aller Beteiligten markiert wird und das eine gegenseitige<br />
Verpfli<strong>ch</strong>tung für die Zukunft begründet 274 . Ri<strong>ch</strong>tig ist dana<strong>ch</strong> genau die Handlungsweise,<br />
auf die si<strong>ch</strong> die Betroffenen in einem hypothetis<strong>ch</strong>en Vertragss<strong>ch</strong>luß einigen<br />
könnten.<br />
Die hobbesianis<strong>ch</strong>e Grundposition spiegelt am besten das (voluntative) Rationalitätskonzept<br />
'Vertrag' wi<strong>der</strong>. In den Interessenabglei<strong>ch</strong>, <strong>der</strong> in einer Vertragsverhandlung<br />
stattfindet, fließt das Streben <strong>der</strong> Verhandlungsparteien na<strong>ch</strong> dem eigenen Vorteil<br />
ungehin<strong>der</strong>t ein 275 . Genau darin liegt die Gewähr von Handlungsri<strong>ch</strong>tigkeit na<strong>ch</strong><br />
<strong>der</strong> hobbesianis<strong>ch</strong>en Grundposition. Kantis<strong>ch</strong>e Vertragstheorien, die <strong>der</strong> Vertragssituation<br />
von vornherein bestimmte moralis<strong>ch</strong>e Bes<strong>ch</strong>ränkungen auferlegen, bedienen<br />
si<strong>ch</strong> demgegenüber nur des Darstellungsmittels 'Vertrag'. Dafür ist Rawls Theorie das<br />
beste Beispiel 276 : bei seinem Urzustand (original position) handelt es si<strong>ch</strong> überhaupt<br />
ni<strong>ch</strong>t um eine Vertragssituation 277 ; die geda<strong>ch</strong>ten Parteien sind dur<strong>ch</strong> ihre künstli<strong>ch</strong>e<br />
Unwissenheit so weitgehend ihrer individuellen Unters<strong>ch</strong>iede beraubt, daß glei<strong>ch</strong>sam<br />
nur no<strong>ch</strong> eine einzige, künstli<strong>ch</strong>e Person übrigbleibt, die dann individuelle Vorteilsüberlegungen<br />
anstellt 278 . Darstellungsmittel und Rationalitätskonzept fallen auseinan<strong>der</strong><br />
279 .<br />
ti nisi nolens.« In <strong>der</strong> Übersetzung von Groner: »Man muß also sagen: an si<strong>ch</strong> und im eigentli<strong>ch</strong>en<br />
Sinn (formell) gespro<strong>ch</strong>en, kann niemand Unre<strong>ch</strong>t tun, es sei denn, er will, und niemand es erleiden,<br />
es sei denn gegen seinen Willen.« Zur zentralen Bedeutung des Satzes für Vertragstheorien<br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong>: A. Gewirth, Political Justice (1962), S. 128 ff. (129); P. Koller, Neue <strong>Theorien</strong><br />
des Sozialkontrakts (1987), S. 12 f.; W. Kersting, Die politis<strong>ch</strong>e Philosophie des Gesells<strong>ch</strong>aftsvertrags<br />
(1994), S. 16, 44.<br />
274 Ähnli<strong>ch</strong> W. Kersting, Die politis<strong>ch</strong>e Philosophie des Gesells<strong>ch</strong>aftsvertrags (1994), S. 16 f. Kersting<br />
unters<strong>ch</strong>eidet (ebd., S. 54 ff.) innerhalb des Rationalitätskonzepts genauer zwis<strong>ch</strong>en 'Vertragsinhaltsargument',<br />
'Vertragssituationsargument' und 'Vertragsbegründungsargument'. Jedes dieser<br />
Teilargumente hat eigene S<strong>ch</strong>wä<strong>ch</strong>en, die hier ni<strong>ch</strong>t untersu<strong>ch</strong>t werden können. Hier geht es zunä<strong>ch</strong>st<br />
nur um die Ungeeignetheit <strong>der</strong> Vertragstheorien als <strong>Theorien</strong>klasse; dazu soglei<strong>ch</strong> S. 102<br />
(Indifferenzeinwand).<br />
275 Vgl. A. Kaufmann, <strong>Prozedurale</strong> <strong>Theorien</strong> <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> (1989), S. 13 – Die Vertragstheorie fingiere<br />
»das sehr kluge und sehr eigennützige Individuum, das uns in <strong>der</strong> klassis<strong>ch</strong>en Nationalökonomie<br />
als <strong>der</strong> homo oeconomicus begegnet.«<br />
276 Vgl. die entspre<strong>ch</strong>ende Eins<strong>ch</strong>ätzung bei G. Lübbe, Die Auferstehung des Sozialvertrags (1977),<br />
S. 190: »Diese Fragen [zum Warum und Wie <strong>der</strong> Gesells<strong>ch</strong>aft] lassen si<strong>ch</strong> nun sämtli<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> unabhängig<br />
von <strong>der</strong> Konstruktion eines Sozialvertrags behandeln, und es fällt s<strong>ch</strong>wer, einzusehen,<br />
inwiefern Argumente für die Vernünftigkeit einer Gesells<strong>ch</strong>aft überzeugen<strong>der</strong> werden dur<strong>ch</strong> Hinzufügen<br />
<strong>der</strong> Behauptung, sie sei wegen dieser Vernünftigkeit au<strong>ch</strong> vertragli<strong>ch</strong> bes<strong>ch</strong>lossen worden.«<br />
Zustimmend K. Homann, Rationalität und Demokratie (1988), S. 213. Vgl. au<strong>ch</strong> unten S. 180<br />
ff. (Zuordnung von Rawls Theorie zu den Grundpositionen).<br />
277 Zu dieser allgemeinen Eins<strong>ch</strong>ätzung in <strong>der</strong> Sekundärliteratur etwa J. Nida-Rümelin, Die beiden<br />
zentralen Intentionen <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> als Fairneß von John Rawls (1990), S. 461;<br />
<strong>der</strong>s., <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> bei John Rawls und Otfried Höffe (1997), S. 312 f.<br />
278 Dazu unten S. 200 ff. (Urzustand bei Rawls).<br />
279 Bezei<strong>ch</strong>nen<strong>der</strong>weise hat Rawls seine Überlegungen zur Moralbegründung lange vor den vertragstheoretis<strong>ch</strong>en<br />
Darstellungen mit einer Beoba<strong>ch</strong>tertheorie begonnen. Seine Erstkonzeption <strong>der</strong> Theorie<br />
<strong>der</strong> <strong>Gere<strong>ch</strong>tigkeit</strong> publizierte er 1957; J. Rawls, Justice as Fairness (1957), S. 653 ff. Sie wurde<br />
von Anfang an als Sozialvertragstheorie angesehen – E.W. Hall, Justice as Fairness: A Mo<strong>der</strong>nized<br />
99


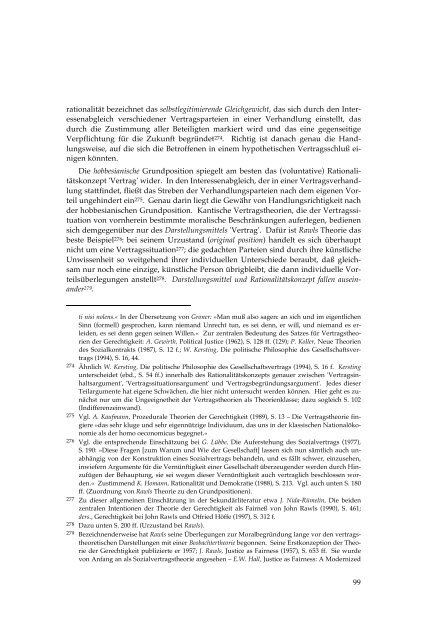



![Seminararbeit [Masterarbeit] - servat.unibe.ch - Universität Bern](https://img.yumpu.com/26241815/1/184x260/seminararbeit-masterarbeit-servatunibech-universitat-bern.jpg?quality=85)









