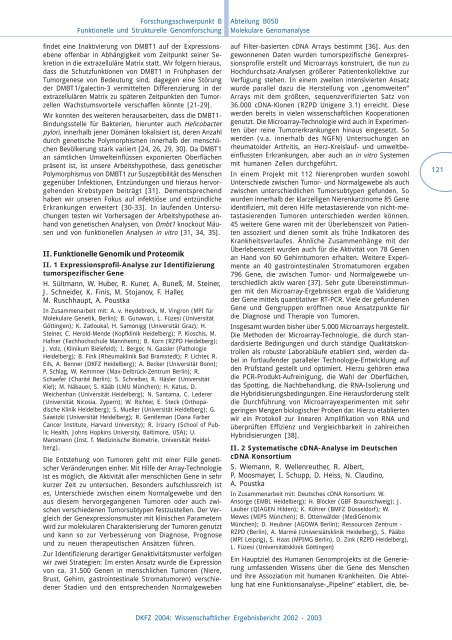MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forschungsschwerpunkt B<br />
Funktionelle und Strukturelle Genomforschung<br />
findet eine Inaktivierung von DMBT1 auf der Expressionsebene<br />
offenbar in Abhängigkeit vom Zeitpunkt seiner Sekretion<br />
in die extrazelluläre Matrix statt. Wir folgern hieraus,<br />
dass die Schutzfunktionen von DMBT1 in Frühphasen der<br />
Tumorgenese von Bedeutung sind, dagegen eine Störung<br />
der DMBT1/galectin-3 vermittelten Differenzierung in der<br />
extrazellulären Matrix zu späteren Zeitpunkten den Tumorzellen<br />
Wachstumsvorteile verschaffen könnte [21-29].<br />
Wir konnten des weiteren herausarbeiten, dass die DMBT1-<br />
Bindungsstelle für Bakterien, hierunter auch Helicobacter<br />
pylori, innerhalb jener Domänen lokalisiert ist, deren Anzahl<br />
durch genetische Polymorphismen innerhalb der menschlichen<br />
Bevölkerung stark variiert [24, 26, 29, 30]. Da DMBT1<br />
an sämtlichen Umwelteinflüssen exponierten Oberflächen<br />
präsent ist, ist unsere Arbeitshypothese, dass genetischer<br />
Polymorphismus von DMBT1 zur Suszeptibilität des Menschen<br />
gegenüber Infektionen, Entzündungen und hieraus hervorgehenden<br />
Krebstypen beiträgt [31]. Dementsprechend<br />
haben wir unseren Fokus auf infektiöse und entzündliche<br />
Erkrankungen erweitert [30-33]. In laufenden Untersuchungen<br />
testen wir Vorhersagen der Arbeitshypothese anhand<br />
von genetischen Analysen, von Dmbt1 knockout Mäusen<br />
und von funktionellen Analysen in vitro [31, 34, 35].<br />
II. Funktionelle Genomik und Proteomik<br />
II. 1 Expressionsprofil-Analyse zur Identifizierung<br />
tumorspezifischer Gene<br />
H. Sültmann, W. Huber, R. Kuner, A. Buneß, M. Steiner,<br />
J. Schneider, K. Finis, M. Stojanov, F. Haller,<br />
M. Ruschhaupt, A. Poustka<br />
In Zusammenarbeit mit: A. v. Heydebreck, M. Vingron (MPI für<br />
Molekulare Genetik, Berlin); B. Gunawan, L. Füzesi (Universität<br />
Göttingen); K. Zatloukal, H. Samonigg (Universität Graz); H.<br />
Steiner, C. Herold-Mende (Kopfklinik Heidelberg); P. Kioschis, M.<br />
Hafner (Fachhochschule Mannheim); B. Korn (RZPD Heidelberg);<br />
J. Volz, (Klinikum Bielefeld); I. Berger, N. Gassler (Pathologie<br />
Heidelberg); B. Fink (Rheumaklinik Bad Bramstedt); P. Lichter, R.<br />
Eils, A. Benner (DKFZ Heidelberg); A. Becker (Universität Bonn);<br />
P. Schlag, W. Kemmner (Max-Delbrück-Zentrum Berlin); R.<br />
Schaefer (Charité Berlin); S. Schreiber, R. Häsler (Universität<br />
Kiel); M. Näbauer, S. Kääb (LMU München); H. Katus, D.<br />
Weichenhan (Universität Heidelberg); N. Santama, C. Lederer<br />
(Universität Nicosia, Zypern); W. Richter, E. Steck (Orthopädische<br />
Klinik Heidelberg); S. Mueller (Universität Heidelberg); G.<br />
Sawitzki (Universität Heidelberg); R. Gentleman (Dana Farber<br />
Cancer Institute, Harvard University); R. Irizarry (School of Public<br />
Health, Johns Hopkins University, Baltimore, USA); U.<br />
Mansmann (Inst. f. Medizinische Biometrie, Universität Heidelberg).<br />
Die Entstehung von Tumoren geht mit einer Fülle genetischer<br />
Veränderungen einher. Mit Hilfe der Array-Technologie<br />
ist es möglich, die Aktivität aller menschlichen Gene in sehr<br />
kurzer Zeit zu untersuchen. Besonders aufschlussreich ist<br />
es, Unterschiede zwischen einem Normalgewebe und den<br />
aus diesem hervorgegangenen Tumoren oder auch zwischen<br />
verschiedenen Tumorsubtypen festzustellen. Der Vergleich<br />
der Genexpressionsmuster mit klinischen Parametern<br />
wird zur molekularen Charakterisierung der Tumoren genutzt<br />
und kann so zur Verbesserung von Diagnose, Prognose<br />
und zu neuen therapeutischen Ansätzen führen.<br />
Zur Identifizierung derartiger Genaktivitätsmuster verfolgen<br />
wir zwei Strategien: Im ersten Ansatz wurde die Expression<br />
von ca. 31.500 Genen in menschlichen Tumoren (Niere,<br />
Brust, Gehirn, gastrointestinale Stromatumoren) verschiedener<br />
Stadien und den entsprechenden Normalgeweben<br />
Abteilung B050<br />
Molekulare Genomanalyse<br />
auf Filter-basierten cDNA Arrays bestimmt [36]. Aus den<br />
gewonnenen Daten wurden tumorspezifische Genexpressionsprofile<br />
erstellt und Microarrays konstruiert, die nun zu<br />
Hochdurchsatz-Analysen größerer Patientenkollektive zur<br />
Verfügung stehen. In einem zweiten intensivierten Ansatz<br />
wurde parallel dazu die Herstellung von „genomweiten“<br />
Arrays mit dem größten, sequenzverifizierten Satz von<br />
36.000 cDNA-Klonen (RZPD Unigene 3.1) erreicht. Diese<br />
werden bereits in vielen wissenschaftlichen Kooperationen<br />
genutzt. Die Microarray-Technologie wird auch in Experimenten<br />
über reine Tumorerkrankungen hinaus eingesetzt. So<br />
werden (v.a. innerhalb des NGFN) Untersuchungen an<br />
rheumatoider Arthritis, an Herz-Kreislauf- und umweltbeeinflussten<br />
Erkrankungen, aber auch an in vitro Systemen<br />
mit humanen Zellen durchgeführt.<br />
In einem Projekt mit 112 Nierenproben wurden sowohl<br />
Unterschiede zwischen Tumor- und Normalgewebe als auch<br />
zwischen unterschiedlichen Tumorsubtypen gefunden. So<br />
wurden innerhalb der klarzelligen Nierenkarzinome 85 Gene<br />
identifiziert, mit deren Hilfe metastasierende von nicht-metastasierenden<br />
Tumoren unterschieden werden können.<br />
45 weitere Gene waren mit der Überlebenszeit von Patienten<br />
assoziiert und dienen somit als frühe Indikatoren des<br />
Krankheitsverlaufes. Ähnliche Zusammenhänge mit der<br />
Überlebenszeit wurden auch für die Aktivität von 78 Genen<br />
an Hand von 60 Gehirntumoren erhalten. Weitere Experimente<br />
an 40 gastrointestinalen Stromatumoren ergaben<br />
796 Gene, die zwischen Tumor- und Normalgewebe unterschiedlich<br />
aktiv waren [37]. Sehr gute Übereinstimmungen<br />
mit den Microarray-Ergebnissen ergab die Validierung<br />
der Gene mittels quantitativer RT-PCR. Viele der gefundenen<br />
Gene und Gengruppen eröffnen neue Ansatzpunkte für<br />
die Diagnose und Therapie von Tumoren.<br />
Insgesamt wurden bisher über 5.000 Microarrays hergestellt.<br />
Die Methoden der Microarray-Technologie, die durch standardisierte<br />
Bedingungen und durch ständige Qualitätskontrollen<br />
als robuste Laborabläufe etabliert sind, werden dabei<br />
in fortlaufender paralleler Technologie-Entwicklung auf<br />
den Prüfstand gestellt und optimiert. Hierzu gehören etwa<br />
die PCR-Produkt-Aufreinigung, die Wahl der Oberflächen,<br />
das Spotting, die Nachbehandlung, die RNA-Isolierung und<br />
die Hybridisierungsbedingungen. Eine Herausforderung stellt<br />
die Durchführung von Microarrayexperimenten mit sehr<br />
geringen Mengen biologischer Proben dar. Hierzu etablierten<br />
wir ein Protokoll zur linearen Amplifikation von RNA und<br />
überprüften Effizienz und Vergleichbarkeit in zahlreichen<br />
Hybridisierungen [38].<br />
II. 2 Systematische cDNA-Analyse im Deutschen<br />
cDNA Konsortium<br />
S. Wiemann, R. Wellenreuther, R. Albert,<br />
P. Moosmayer, I. Schupp, D. Heiss, N. Claudino,<br />
A. Poustka<br />
In Zusammenarbeit mit: Deutsches cDNA Konsortium: W.<br />
Ansorge (EMBL Heidelberg); H. Blöcker (GBF Braunschweig); J.<br />
Lauber (QIAGEN Hilden); K. Köhrer (BMFZ Düsseldorf); W.<br />
Mewes (MIPS München); B. Ottenwälder (MediGenomix<br />
München); D. Heubner (AGOWA Berlin); Ressourcen Zentrum -<br />
RZPD (Berlin), A. Marmè (Universiätsklinik Heidelberg), S. Pääbo<br />
(MPI Leipzig), S. Haas (MPIMG Berlin), D. Zink (RZPD Heidelberg),<br />
L. Füzesi (Universitätsklinik Göttingen)<br />
Ein Hauptziel des Humanen Genomprojekts ist die Generierung<br />
umfassenden Wissens über die Gene des Menschen<br />
und ihre Assoziation mit humanen Krankheiten. Die Abteilung<br />
hat eine Funktionsanalyse-„Pipeline“ etabliert, die, be-<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
121