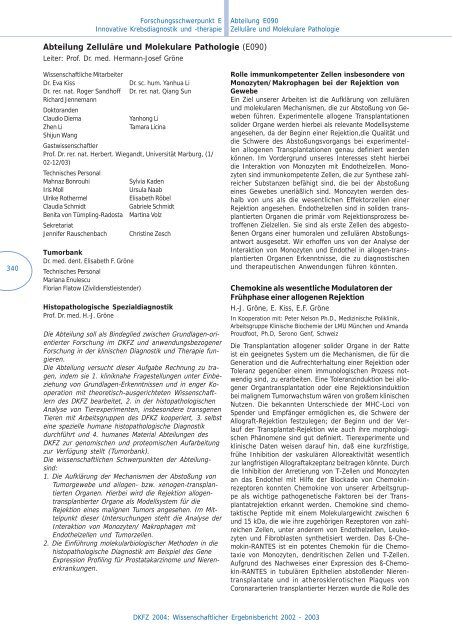MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
340<br />
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
Abteilung Zelluläre und Molekulare Pathologie (E090)<br />
Leiter: Prof. Dr. med. Hermann-Josef Gröne<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Dr. Eva Kiss Dr. sc. hum. Yanhua Li<br />
Dr. rer. nat. Roger Sandhoff Dr. rer. nat. Qiang Sun<br />
Richard Jennemann<br />
Doktoranden<br />
Claudio Diema Yanhong Li<br />
Zhen Li Tamara Licina<br />
Shijun Wang<br />
Gastwissenschaftler<br />
Prof. Dr. rer. nat. Herbert. Wiegandt, Universität Marburg, (1/<br />
02-12/03)<br />
Technisches Personal<br />
Mahnaz Bonrouhi Sylvia Kaden<br />
Iris Moll Ursula Naab<br />
Ulrike Rothermel Elisabeth Röbel<br />
Claudia Schmidt Gabriele Schmidt<br />
Benita von Tümpling-Radosta Martina Volz<br />
Sekretariat<br />
Jennifer Rauschenbach Christine Zesch<br />
Tumorbank<br />
Dr. med. dent. Elisabeth F. Gröne<br />
Technisches Personal<br />
Mariana Enulescu<br />
Florian Flatow (Zivildienstleistender)<br />
Histopathologische Spezialdiagnostik<br />
Prof. Dr. med. H.-J. Gröne<br />
Die Abteilung soll als Bindeglied zwischen Grundlagen-orientierter<br />
Forschung im DKFZ und anwendungsbezogener<br />
Forschung in der klinischen Diagnostik und Therapie fungieren.<br />
Die Abteilung versucht dieser Aufgabe Rechnung zu tragen,<br />
indem sie 1. kliniknahe Fragestellungen unter Einbeziehung<br />
von Grundlagen-Erkenntnissen und in enger Kooperation<br />
mit theoretisch-ausgerichteten Wissenschaftlern<br />
des DKFZ bearbeitet, 2. in der histopathologischen<br />
Analyse von Tierexperimenten, insbesondere transgenen<br />
Tieren mit Arbeitsgruppen des DFKZ kooperiert, 3. selbst<br />
eine spezielle humane histopathologische Diagnostik<br />
durchführt und 4. humanes Material Abteilungen des<br />
DKFZ zur genomischen und proteomischen Aufarbeitung<br />
zur Verfügung stellt (Tumorbank).<br />
Die wissenschaftlichen Schwerpunkten der Abteilungsind:<br />
1. Die Aufklärung der Mechanismen der Abstoßung von<br />
Tumorgewebe und allogen- bzw. xenogen-transplantierten<br />
Organen. Hierbei wird die Rejektion allogentransplantierter<br />
Organe als Modellsystem für die<br />
Rejektion eines malignen Tumors angesehen. Im Mittelpunkt<br />
dieser Untersuchungen steht die Analyse der<br />
Interaktion von Monozyten/ Makrophagen mit<br />
Endothelzellen und Tumorzellen.<br />
2. Die Einführung molekularbiologischer Methoden in die<br />
histopathologische Diagnostik am Beispiel des Gene<br />
Expression Profiling für Prostatakarzinome und Nierenerkrankungen.<br />
Abteilung E090<br />
Zelluläre und Molekulare Pathologie<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Rolle immunkompetenter Zellen insbesondere von<br />
Monozyten/Makrophagen bei der Rejektion von<br />
Gewebe<br />
Ein Ziel unserer Arbeiten ist die Aufklärung von zellulären<br />
und molekularen Mechanismen, die zur Abstoßung von Geweben<br />
führen. Experimentelle allogene Transplantationen<br />
solider Organe werden hierbei als relevante Modellsysteme<br />
angesehen, da der Beginn einer Rejektion,die Qualität und<br />
die Schwere des Abstoßungsvorgangs bei experimentellen<br />
allogenen Transplantationen genau definiert werden<br />
können. Im Vordergrund unseres Interesses steht hierbei<br />
die Interaktion von Monozyten mit Endothelzellen. Monozyten<br />
sind immunkompetente Zellen, die zur Synthese zahlreicher<br />
Substanzen befähigt sind, die bei der Abstoßung<br />
eines Gewebes unerläßlich sind. Monozyten werden deshalb<br />
von uns als die wesentlichen Effektorzellen einer<br />
Rejektion angesehen. Endothelzellen sind in soliden transplantierten<br />
Organen die primär vom Rejektionsprozess betroffenen<br />
Zielzellen. Sie sind als erste Zellen des abgestoßenen<br />
Organs einer humoralen und zellulären Abstoßungsantwort<br />
ausgesetzt. Wir erhoffen uns von der Analyse der<br />
Interaktion von Monozyten und Endothel in allogen-transplantierten<br />
Organen Erkenntnisse, die zu diagnostischen<br />
und therapeutischen Anwendungen führen könnten.<br />
Chemokine als wesentliche Modulatoren der<br />
Frühphase einer allogenen Rejektion<br />
H.-J. Gröne, E. Kiss, E.F. Gröne<br />
In Kooperation mit: Peter Nelson Ph.D., Medizinische Poliklinik,<br />
Arbeitsgruppe Klinische Biochemie der LMU München und Amanda<br />
Proudfoot, Ph.D, Serono Genf, Schweiz<br />
Die Transplantation allogener solider Organe in der Ratte<br />
ist ein geeignetes System um die Mechanismen, die für die<br />
Generation und die Aufrechterhaltung einer Rejektion oder<br />
Toleranz gegenüber einem immunologischen Prozess notwendig<br />
sind, zu erarbeiten. Eine Toleranzinduktion bei allogener<br />
Organtransplantation oder eine Rejektionsinduktion<br />
bei malignem Tumorwachstum wären von großem klinischen<br />
Nutzen. Die bekannten Unterschiede der MHC-Loci von<br />
Spender und Empfänger ermöglichen es, die Schwere der<br />
Allograft-Rejektion festzulegen; der Beginn und der Verlauf<br />
der Transplantat-Rejektion wie auch ihre morphologischen<br />
Phänomene sind gut definiert. Tierexperimente und<br />
klinische Daten weisen darauf hin, daß eine kurzfristige,<br />
frühe Inhibition der vaskulären Alloreaktivität wesentlich<br />
zur langfristigen Allograftakzeptanz beitragen könnte. Durch<br />
die Inhibition der Arretierung von T-Zellen und Monozyten<br />
an das Endothel mit Hilfe der Blockade von Chemokinrezeptoren<br />
konnten Chemokine von unserer Arbeitsgruppe<br />
als wichtige pathogenetische Faktoren bei der Transplantatrejektion<br />
erkannt werden. Chemokine sind chemotaktische<br />
Peptide mit einem Molekulargewicht zwischen 6<br />
und 15 kDa, die wie ihre zugehörigen Rezeptoren von zahlreichen<br />
Zellen, unter anderem von Endothelzellen, Leukozyten<br />
und Fibroblasten synthetisiert werden. Das ß-Chemokin-RANTES<br />
ist ein potentes Chemokin für die Chemotaxie<br />
von Monozyten, dendritischen Zellen und T-Zellen.<br />
Aufgrund des Nachweises einer Expression des ß-Chemokin-RANTES<br />
in tubulären Epithelien abstoßender Nierentransplantate<br />
und in atherosklerotischen Plaques von<br />
Coronararterien transplantierter Herzen wurde die Rolle des