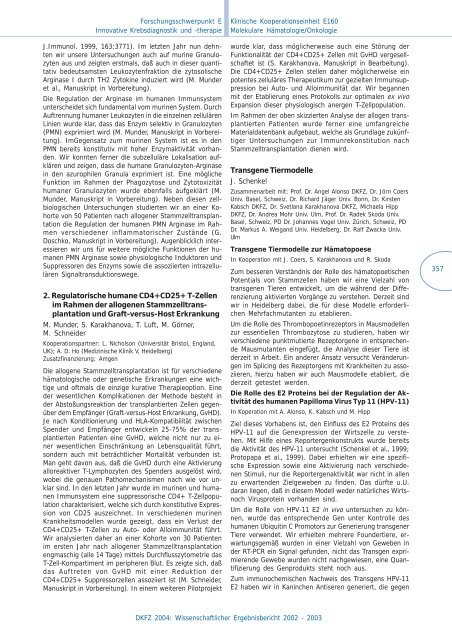MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
J.Immunol. 1999, 163:3771). Im letzten Jahr nun dehnten<br />
wir unsere Untersuchungen auch auf murine Granulozyten<br />
aus und zeigten erstmals, daß auch in dieser quantitativ<br />
bedeutsamsten Leukozytenfraktion die zytosolische<br />
Arginase I durch TH2 Zytokine induziert wird (M. Munder<br />
et al., Manuskript in Vorbereitung).<br />
Die Regulation der Arginase im humanen Immunsystem<br />
unterscheidet sich fundamental vom murinen System. Durch<br />
Auftrennung humaner Leukozyten in die einzelnen zellulären<br />
Linien wurde klar, dass das Enzym selektiv in Granulozyten<br />
(PMN) exprimiert wird (M. Munder, Manuskript in Vorbereitung).<br />
ImGegensatz zum murinen System ist es in den<br />
PMN bereits konstitutiv mit hoher Enzymaktivität vorhanden.<br />
Wir konnten ferner die subzelluläre Lokalisation aufklären<br />
und zeigen, dass die humane Granulozyten-Arginase<br />
in den azurophilen Granula exprimiert ist. Eine mögliche<br />
Funktion im Rahmen der Phagozytose und Zytotoxizität<br />
humaner Granulozyten wurde ebenfalls aufgeklärt (M.<br />
Munder, Manuskript in Vorbereitung). Neben diesen zellbiologischen<br />
Untersuchungen studierten wir an einer Kohorte<br />
von 50 Patienten nach allogener Stammzelltransplantation<br />
die Regulation der humanen PMN Arginase im Rahmen<br />
verschiedener inflammatorischer Zustände (G.<br />
Doschko, Manuskript in Vorbereitung). Augenblicklich interessieren<br />
wir uns für weitere mögliche Funktionen der humanen<br />
PMN Arginase sowie physiologische Induktoren und<br />
Suppressoren des Enzyms sowie die assoziierten intrazellulären<br />
Signaltransduktionswege.<br />
2. Regulatorische humane CD4+CD25+ T-Zellen<br />
im Rahmen der allogenen Stammzelltransplantation<br />
und Graft-versus-Host Erkrankung<br />
M. Munder, S. Karakhanova, T. Luft, M. Görner,<br />
M. Schneider<br />
Kooperationspartner: L. Nicholson (Universität Bristol, England,<br />
UK); A. D. Ho (Medizinische Klinik V, Heidelberg)<br />
Zusatzfinanzierung: Amgen<br />
Die allogene Stammzelltransplantation ist für verschiedene<br />
hämatologische oder genetische Erkrankungen eine wichtige<br />
und oftmals die einzige kurative Therapieoption. Eine<br />
der wesentlichen Komplikationen der Methode besteht in<br />
der Abstoßungsreaktion der transplantierten Zellen gegenüber<br />
dem Empfänger (Graft-versus-Host Erkrankung, GvHD).<br />
Je nach Konditionierung und HLA-Kompatibilität zwischen<br />
Spender und Empfänger entwickeln 25-75% der transplantierten<br />
Patienten eine GvHD, welche nicht nur zu einer<br />
wesentlichen Einschränkung an Lebensqualität führt,<br />
sondern auch mit beträchtlicher Mortalität verbunden ist.<br />
Man geht davon aus, daß die GvHD durch eine Aktivierung<br />
alloreaktiver T-Lymphozyten des Spenders ausgelöst wird,<br />
wobei die genauen Pathomechanismen nach wie vor unklar<br />
sind. In den letzten Jahr wurde im murinen und humanen<br />
Immunsystem eine suppressorische CD4+ T-Zellpopulation<br />
charakterisiert, welche sich durch konstitutive Expression<br />
von CD25 auszeichnet. In verschiedenen murinen<br />
Krankheitsmodellen wurde gezeigt, dass ein Verlust der<br />
CD4+CD25+ T-Zellen zu Auto- oder Alloimmunität führt.<br />
Wir analysierten daher an einer Kohorte von 30 Patienten<br />
im ersten Jahr nach allogener Stammzelltransplantation<br />
engmaschig (alle 14 Tage) mittels Durchflusszytometrie das<br />
T-Zell-Kompartiment im peripheren Blut. Es zeigte sich, daß<br />
das Auftreten von GvHD mit einer Reduktion der<br />
CD4+CD25+ Suppressorzellen assoziiert ist (M. Schneider,<br />
Manuskript in Vorbereitung). In einem weiteren Pilotprojekt<br />
Klinische Kooperationseinheit E160<br />
Molekulare Hämatologie/Onkologie<br />
wurde klar, dass möglicherweise auch eine Störung der<br />
Funktionalität der CD4+CD25+ Zellen mit GvHD vergesellschaftet<br />
ist (S. Karakhanova, Manuskript in Bearbeitung).<br />
Die CD4+CD25+ Zellen stellen daher möglicherweise ein<br />
potentes zelluläres Therapeutikum zur gezielten Immunsuppression<br />
bei Auto- und Alloimmunität dar. Wir begannen<br />
mit der Etablierung eines Protokolls zur optimalen ex vivo<br />
Expansion dieser physiologisch anergen T-Zellpopulation.<br />
Im Rahmen der oben skizzierten Analyse der allogen transplantierten<br />
Patienten wurde ferner eine umfangreiche<br />
Materialdatenbank aufgebaut, welche als Grundlage zukünftiger<br />
Untersuchungen zur Immunrekonstitution nach<br />
Stammzelltransplantation dienen wird.<br />
Transgene Tiermodelle<br />
J. Schenkel<br />
Zusammenarbeit mit: Prof. Dr. Angel Alonso DKFZ, Dr. Jörn Coers<br />
Univ. Basel, Schweiz, Dr. Richard Jäger Univ. Bonn, Dr. Kirsten<br />
Kabsch DKFZ, Dr. Svetlana Karakhanova DKFZ, Michaela Hipp<br />
DKFZ, Dr. Andrea Mohr Univ. Ulm, Prof. Dr. Radek Skoda Univ.<br />
Basel, Schweiz, PD Dr. Johannes Vogel Univ. Zürich, Schweiz, PD<br />
Dr. Markus A. Weigand Univ. Heidelberg, Dr. Ralf Zwacka Univ.<br />
Ulm<br />
Transgene Tiermodelle zur Hämatopoese<br />
In Kooperation mit J. Coers, S. Karakhanova und R. Skoda<br />
Zum besseren Verständnis der Rolle des hämatopoetischen<br />
Potentials von Stammzellen haben wir eine Vielzahl von<br />
transgenen Tieren entwickelt, um die während der Differenzierung<br />
aktivierten Vorgänge zu verstehen. Derzeit sind<br />
wir in Heidelberg dabei, die für diese Modelle erforderlichen<br />
Mehrfachmutanten zu etablieren.<br />
Um die Rolle des Thrombopoetinrezeptors in Mausmodellen<br />
zur essentiellen Thrombozytose zu studieren, haben wir<br />
verschiedene punktmutierte Rezeptorgene in entsprechende<br />
Mausmutanten eingefügt, die Analyse dieser Tiere ist<br />
derzeit in Arbeit. Ein anderer Ansatz versucht Veränderungen<br />
im Splicing des Rezeptorgens mit Krankheiten zu assoziieren,<br />
hierzu haben wir auch Mausmodelle etabliert, die<br />
derzeit getestet werden.<br />
Die Rolle des E2 Proteins bei der Regulation der Aktivität<br />
des humanen Papilloma Virus Typ 11 (HPV-11)<br />
In Koperation mit A. Alonso, K. Kabsch und M. Hipp<br />
Ziel dieses Vorhabens ist, den Einfluss des E2 Proteins des<br />
HPV-11 auf die Genexpression der Wirtszelle zu verstehen.<br />
Mit Hilfe eines Reportergenkonstrukts wurde bereits<br />
die Aktivität des HPV-11 untersucht (Schenkel et al., 1999;<br />
Protopapa et al., 1999). Dabei erhielten wir eine spezifische<br />
Expression sowie eine Aktivierung nach verschiedenen<br />
Stimuli, nur die Reportergenaktivität war nicht in allen<br />
zu erwartenden Zielgeweben zu finden. Das dürfte u.U.<br />
daran liegen, daß in diesem Modell weder natürliches Wirtsnoch<br />
Virusprotein vorhanden sind.<br />
Um die Rolle von HPV-11 E2 in vivo untersuchen zu können,<br />
wurde das entsprechende Gen unter Kontrolle des<br />
humanen Ubiquitin C Promotors zur Generierung transgener<br />
Tiere verwendet. Wir erhielten mehrere Foundertiere, erwartungsgemäß<br />
wurden in einer Vielzahl von Geweben in<br />
der RT-PCR ein Signal gefunden, nicht das Transgen exprimierende<br />
Gewebe wurden nicht nachgewiesen, eine Quantifizierung<br />
des Genprodukts steht noch aus.<br />
Zum immunochemischen Nachweis des Transgens HPV-11<br />
E2 haben wir in Kaninchen Antiseren generiert, die gegen<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
357