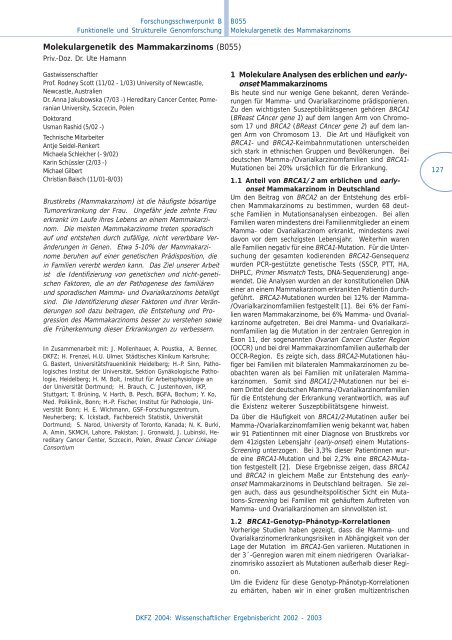MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt B<br />
Funktionelle und Strukturelle Genomforschung<br />
Molekulargenetik des Mammakarzinoms (B055)<br />
Priv.-Doz. Dr. Ute Hamann<br />
Gastwissenschaftler<br />
Prof. Rodney Scott (11/02 - 1/03) University of Newcastle,<br />
Newcastle, Australien<br />
Dr. Anna Jakubowska (7/03 -) Hereditary Cancer Center, Pomeranian<br />
University, Sczcecin, Polen<br />
Doktorand<br />
Usman Rashid (5/02 -)<br />
Technische Mitarbeiter<br />
Antje Seidel-Renkert<br />
Michaela Schleicher (- 9/02)<br />
Karin Schüssler (2/03 -)<br />
Michael Gilbert<br />
Christian Baisch (11/01-8/03)<br />
Brustkrebs (Mammakarzinom) ist die häufigste bösartige<br />
Tumorerkrankung der Frau. Ungefähr jede zehnte Frau<br />
erkrankt im Laufe ihres Lebens an einem Mammakarzinom.<br />
Die meisten Mammakarzinome treten sporadisch<br />
auf und entstehen durch zufällige, nicht vererbbare Veränderungen<br />
in Genen. Etwa 5-10% der Mammakarzinome<br />
beruhen auf einer genetischen Prädisposition, die<br />
in Familien vererbt werden kann. Das Ziel unserer Arbeit<br />
ist die Identifizierung von genetischen und nicht-genetischen<br />
Faktoren, die an der Pathogenese des familiären<br />
und sporadischen Mamma- und Ovarialkarzinoms beteiligt<br />
sind. Die Identifizierung dieser Faktoren und ihrer Veränderungen<br />
soll dazu beitragen, die Entstehung und Progression<br />
des Mammakarzinoms besser zu verstehen sowie<br />
die Früherkennung dieser Erkrankungen zu verbessern.<br />
In Zusammenarbeit mit: J. Mollenhauer, A. Poustka, A. Benner,<br />
DKFZ; H. Frenzel, H.U. Ulmer, Städtisches Klinikum Karlsruhe;<br />
G. Bastert, Universitätsfrauenklinik Heidelberg; H.-P. Sinn, Pathologisches<br />
Institut der Universität, Sektion Gynäkologische Pathologie,<br />
Heidelberg; H. M. Bolt, Institut für Arbeitsphysiologie an<br />
der Universität Dortmund; H. Brauch, C. Justenhoven, IKP,<br />
Stuttgart; T. Brüning, V. Harth, B. Pesch, BGFA, Bochum; Y. Ko,<br />
Med. Poliklinik, Bonn; H.-P. Fischer, Institut für Pathologie, Universität<br />
Bonn; H. E. Wichmann, GSF-Forschungszentrum,<br />
Neuherberg; K. Ickstadt, Fachbereich Statistik, Universität<br />
Dortmund; S. Narod, University of Toronto, Kanada; N. K. Burki,<br />
A. Amin, SKMCH, Lahore, Pakistan; J. Gronwald, J. Lubinski, Hereditary<br />
Cancer Center, Sczcecin, Polen, Breast Cancer Linkage<br />
Consortium<br />
B055<br />
Molekulargenetik des Mammakarzinoms<br />
1 Molekulare Analysen des erblichen und earlyonset<br />
Mammakarzinoms<br />
Bis heute sind nur wenige Gene bekannt, deren Veränderungen<br />
für Mamma- und Ovarialkarzinome prädisponieren.<br />
Zu den wichtigsten Suszeptibilitätsgenen gehören BRCA1<br />
(BReast CAncer gene 1) auf dem langen Arm von Chromosom<br />
17 und BRCA2 (BReast CAncer gene 2) auf dem langen<br />
Arm von Chromosom 13. Die Art und Häufigkeit von<br />
BRCA1- und BRCA2-Keimbahnmutationen unterscheiden<br />
sich stark in ethnischen Gruppen und Bevölkerungen. Bei<br />
deutschen Mamma-/Ovarialkarzinomfamilien sind BRCA1-<br />
Mutationen bei 20% ursächlich für die Erkrankung.<br />
1.1 Anteil von BRCA1/2 am erblichen und earlyonset<br />
Mammakarzinom in Deutschland<br />
Um den Beitrag von BRCA2 an der Entstehung des erblichen<br />
Mammakarzinoms zu bestimmen, wurden 68 deutsche<br />
Familien in Mutationsanalysen einbezogen. Bei allen<br />
Familien waren mindestens drei Familienmitglieder an einem<br />
Mamma- oder Ovarialkarzinom erkrankt, mindestens zwei<br />
davon vor dem sechzigsten Lebensjahr. Weiterhin waren<br />
alle Familien negativ für eine BRCA1-Mutation. Für die Untersuchung<br />
der gesamten kodierenden BRCA2-Gensequenz<br />
wurden PCR-gestützte genetische Tests (SSCP, PTT, HA,<br />
DHPLC, Primer Mismatch Tests, DNA-Sequenzierung) angewendet.<br />
Die Analysen wurden an der konstitutionellen DNA<br />
einer an einem Mammakarzinom erkrankten Patientin durchgeführt.<br />
BRCA2-Mutationen wurden bei 12% der Mamma-<br />
/Ovarialkarzinomfamilien festgestellt [1]. Bei 6% der Familien<br />
waren Mammakarzinome, bei 6% Mamma- und Ovarialkarzinome<br />
aufgetreten. Bei drei Mamma- und Ovarialkarzinomfamilien<br />
lag die Mutation in der zentralen Genregion in<br />
Exon 11, der sogenannten Ovarian Cancer Cluster Region<br />
(OCCR) und bei drei Mammakarzinomfamilien außerhalb der<br />
OCCR-Region. Es zeigte sich, dass BRCA2-Mutationen häufiger<br />
bei Familien mit bilateralen Mammakarzinomen zu beobachten<br />
waren als bei Familien mit unilateralen Mammakarzinomen.<br />
Somit sind BRCA1/2-Mutationen nur bei einem<br />
Drittel der deutschen Mamma-/Ovarialkarzinomfamilien<br />
für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich, was auf<br />
die Existenz weiterer Suszeptibilitätsgene hinweist.<br />
Da über die Häufigkeit von BRCA1/2-Mutatinen außer bei<br />
Mamma-/Ovarialkarzinomfamilien wenig bekannt war, haben<br />
wir 91 Patientinnen mit einer Diagnose von Brustkrebs vor<br />
dem 41zigsten Lebensjahr (early-onset) einem Mutations-<br />
Screening unterzogen. Bei 3,3% dieser Patientinnen wurde<br />
eine BRCA1-Mutation und bei 2,2% eine BRCA2-Mutation<br />
festgestellt [2]. Diese Ergebnisse zeigen, dass BRCA1<br />
und BRCA2 in gleichem Maße zur Entstehung des earlyonset<br />
Mammakarzinoms in Deutschland beitragen. Sie zeigen<br />
auch, dass aus gesundheitspolitischer Sicht ein Mutations-Screening<br />
bei Familien mit gehäuftem Auftreten von<br />
Mamma- und Ovarialkarzinomen am sinnvollsten ist.<br />
1.2 BRCA1-Genotyp-Phänotyp-Korrelationen<br />
Vorherige Studien haben gezeigt, dass die Mamma- und<br />
Ovarialkarzinomerkrankungsrisiken in Abhängigkeit von der<br />
Lage der Mutation im BRCA1-Gen variieren. Mutationen in<br />
der 3´-Genregion waren mit einem niedrigeren Ovarialkarzinomrisiko<br />
assoziiert als Mutationen außerhalb dieser Region.<br />
Um die Evidenz für diese Genotyp-Phänotyp-Korrelationen<br />
zu erhärten, haben wir in einer großen multizentrischen<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
127