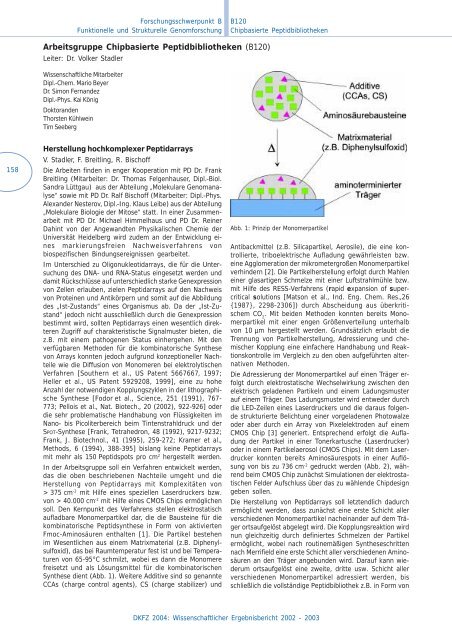MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
158<br />
Forschungsschwerpunkt B<br />
Funktionelle und Strukturelle Genomforschung<br />
Arbeitsgruppe Chipbasierte Peptidbibliotheken (B120)<br />
Leiter: Dr. Volker Stadler<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Dipl.-Chem. Mario Beyer<br />
Dr. Simon Fernandez<br />
Dipl.-Phys. Kai König<br />
Doktoranden<br />
Thorsten Kühlwein<br />
Tim Seeberg<br />
Herstellung hochkomplexer Peptidarrays<br />
V. Stadler, F. Breitling, R. Bischoff<br />
Die Arbeiten finden in enger Kooperation mit PD Dr. Frank<br />
Breitling (Mitarbeiter: Dr. Thomas Felgenhauser, Dipl.-Biol.<br />
Sandra Lüttgau) aus der Abteilung „Molekulare Genomanalyse“<br />
sowie mit PD Dr. Ralf Bischoff (Mitarbeiter: Dipl.-Phys.<br />
Alexander Nesterov, Dipl.-Ing. Klaus Leibe) aus der Abteilung<br />
„Molekulare Biologie der Mitose“ statt. In einer Zusammenarbeit<br />
mit PD Dr. Michael Himmelhaus und PD Dr. Reiner<br />
Dahint von der Angewandten Physikalischen Chemie der<br />
Universität Heidelberg wird zudem an der Entwicklung eines<br />
markierungsfreien Nachweisverfahrens von<br />
biospezifischen Bindungsereignissen gearbeitet.<br />
Im Unterschied zu Oligonukleotidarrays, die für die Untersuchung<br />
des DNA- und RNA-Status eingesetzt werden und<br />
damit Rückschlüsse auf unterschiedlich starke Genexpression<br />
von Zellen erlauben, zielen Peptidarrays auf den Nachweis<br />
von Proteinen und Antikörpern und somit auf die Abbildung<br />
des „Ist-Zustands“ eines Organismus ab. Da der „Ist-Zustand“<br />
jedoch nicht ausschließlich durch die Genexpression<br />
bestimmt wird, sollten Peptidarrays einen wesentlich direkteren<br />
Zugriff auf charakteristische Signalmuster bieten, die<br />
z.B. mit einem pathogenen Status einhergehen. Mit den<br />
verfügbaren Methoden für die kombinatorische Synthese<br />
von Arrays konnten jedoch aufgrund konzeptioneller Nachteile<br />
wie die Diffusion von Monomeren bei elektrolytischen<br />
Verfahren [Southern et al., US Patent 5667667, 1997;<br />
Heller et al., US Patent 5929208, 1999], eine zu hohe<br />
Anzahl der notwendigen Kopplungszyklen in der lithographische<br />
Synthese [Fodor et al., Science, 251 (1991), 767-<br />
773; Pellois et al., Nat. Biotech., 20 (2002), 922-926] oder<br />
die sehr problematische Handhabung von Flüssigkeiten im<br />
Nano- bis Picoliterbereich beim Tintenstrahldruck und der<br />
SPOT-Synthese [Frank, Tetrahedron, 48 (1992), 9217-9232;<br />
Frank, J. Biotechnol., 41 (1995), 259-272; Kramer et al.,<br />
Methods, 6 (1994), 388-395] bislang keine Peptidarrays<br />
mit mehr als 150 Peptidspots pro cm2 hergestellt werden.<br />
In der Arbeitsgruppe soll ein Verfahren entwickelt werden,<br />
das die oben beschriebenen Nachteile umgeht und die<br />
Herstellung von Peptidarrays mit Komplexitäten von<br />
> 375 cm-2 mit Hilfe eines speziellen Laserdruckers bzw.<br />
von > 40.000 cm-2 mit Hilfe eines CMOS Chips ermöglichen<br />
soll. Den Kernpunkt des Verfahrens stellen elektrostatisch<br />
aufladbare Monomerpartikel dar, die die Bausteine für die<br />
kombinatorische Peptidsynthese in Form von aktivierten<br />
Fmoc-Aminosäuren enthalten [1]. Die Partikel bestehen<br />
im Wesentlichen aus einem Matrixmaterial (z.B. Diphenylsulfoxid),<br />
das bei Raumtemperatur fest ist und bei Temperaturen<br />
von 65-95°C schmilzt, wobei es dann die Monomere<br />
freisetzt und als Lösungsmittel für die kombinatorischen<br />
Synthese dient (Abb. 1). Weitere Additive sind so genannte<br />
CCAs (charge control agents), CS (charge stabilizer) und<br />
B120<br />
Chipbasierte Peptidbibliotheken<br />
Abb. 1: Prinzip der Monomerpartikel<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Antibackmittel (z.B. Silicapartikel, Aerosile), die eine kontrollierte,<br />
triboelektrische Aufladung gewährleisten bzw.<br />
eine Agglomeration der mikrometergroßen Monomerpartikel<br />
verhindern [2]. Die Partikelherstellung erfolgt durch Mahlen<br />
einer glasartigen Schmelze mit einer Luftstrahlmühle bzw.<br />
mit Hilfe des RESS-Verfahrens (rapid expansion of supercritical<br />
solutions [Matson et al., Ind. Eng. Chem. Res.,26<br />
{1987}, 2298-2306]) durch Abscheidung aus überkritischem<br />
CO . Mit beiden Methoden konnten bereits Mono-<br />
2<br />
merpartikel mit einer engen Größenverteilung unterhalb<br />
von 10 µm hergestellt werden. Grundsätzlich erlaubt die<br />
Trennung von Partikelherstellung, Adressierung und chemischer<br />
Kopplung eine einfachere Handhabung und Reaktionskontrolle<br />
im Vergleich zu den oben aufgeführten alternativen<br />
Methoden.<br />
Die Adressierung der Monomerpartikel auf einen Träger erfolgt<br />
durch elektrostatische Wechselwirkung zwischen den<br />
elektrisch geladenen Partikeln und einem Ladungsmuster<br />
auf einem Träger. Das Ladungsmuster wird entweder durch<br />
die LED-Zeilen eines Laserdruckers und die daraus folgende<br />
strukturierte Belichtung einer vorgeladenen Photowalze<br />
oder aber durch ein Array von Pixelelektroden auf einem<br />
CMOS Chip [3] generiert. Entsprechend erfolgt die Aufladung<br />
der Partikel in einer Tonerkartusche (Laserdrucker)<br />
oder in einem Partikelaerosol (CMOS Chips). Mit dem Laserdrucker<br />
konnten bereits Aminosäurespots in einer Auflösung<br />
von bis zu 736 cm-2 gedruckt werden (Abb. 2), während<br />
beim CMOS Chip zunächst Simulationen der elektrostatischen<br />
Felder Aufschluss über das zu wählende Chipdesign<br />
geben sollen.<br />
Die Herstellung von Peptidarrays soll letztendlich dadurch<br />
ermöglicht werden, dass zunächst eine erste Schicht aller<br />
verschiedenen Monomerpartikel nacheinander auf dem Träger<br />
ortsaufgelöst abgelegt wird. Die Kopplungsreaktion wird<br />
nun gleichzeitig durch definiertes Schmelzen der Partikel<br />
ermöglicht, wobei nach routinemäßigen Syntheseschritten<br />
nach Merrifield eine erste Schicht aller verschiedenen Aminosäuren<br />
an den Träger angebunden wird. Darauf kann wiederum<br />
ortsaufgelöst eine zweite, dritte usw. Schicht aller<br />
verschiedenen Monomerpartikel adressiert werden, bis<br />
schließlich die vollständige Peptidbibliothek z.B. in Form von