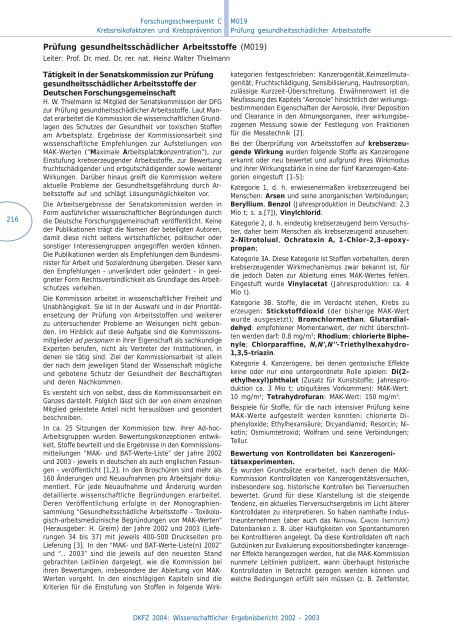MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
216<br />
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention<br />
Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (M019)<br />
Leiter: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Heinz Walter Thielmann<br />
Tätigkeit in der Senatskommission zur Prüfung<br />
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der<br />
Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
H. W. Thielmann ist Mitglied der Senatskommission der DFG<br />
zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. Laut Mandat<br />
erarbeitet die Kommission die wissenschaftlichen Grundlagen<br />
des Schutzes der Gesundheit vor toxischen Stoffen<br />
am Arbeitsplatz. Ergebnisse der Kommissionsarbeit sind<br />
wissenschaftliche Empfehlungen zur Aufstellungen von<br />
MAK-Werten (“Maximale Arbeitsplatzkonzentration”), zur<br />
Einstufung krebserzeugender Arbeitsstoffe, zur Bewertung<br />
fruchtschädigender und erbgutschädigender sowie weiterer<br />
Wirkungen. Darüber hinaus greift die Kommission weitere<br />
aktuelle Probleme der Gesundheitsgefährdung durch Arbeitsstoffe<br />
auf und schlägt Lösungsmöglichkeiten vor.<br />
Die Arbeitsergebnisse der Senatskommission werden in<br />
Form ausführlicher wissenschaftlicher Begründungen durch<br />
die Deutsche Forschungsgemeinschaft veröffentlicht. Keine<br />
der Publikationen trägt die Namen der beteiligten Autoren,<br />
damit diese nicht seitens wirtschaftlicher, politischer oder<br />
sonstiger Interessengruppen angegriffen werden können.<br />
Die Publikationen werden als Empfehlungen dem Bundesminister<br />
für Arbeit und Sozialordnung übergeben. Dieser kann<br />
den Empfehlungen - unverändert oder geändert - in geeigneter<br />
Form Rechtsverbindlichkeit als Grundlage des Arbeitschutzes<br />
verleihen.<br />
Die Kommission arbeitet in wissenschaftlicher Freiheit und<br />
Unabhängigkeit. Sie ist in der Auswahl und in der Prioritätensetzung<br />
der Prüfung von Arbeitsstoffen und weiterer<br />
zu untersuchender Probleme an Weisungen nicht gebunden.<br />
Im Hinblick auf diese Aufgabe sind die Kommissionsmitglieder<br />
ad personam in ihrer Eigenschaft als sachkundige<br />
Experten berufen, nicht als Vertreter der Institutionen, in<br />
denen sie tätig sind. Ziel der Kommissionsarbeit ist allein<br />
der nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft mögliche<br />
und gebotene Schutz der Gesundheit der Beschäftigten<br />
und deren Nachkommen.<br />
Es versteht sich von selbst, dass die Kommissionsarbeit ein<br />
Ganzes darstellt. Folglich lässt sich der von einem einzelnen<br />
Mitglied geleistete Anteil nicht herauslösen und gesondert<br />
beschreiben.<br />
In ca. 25 Sitzungen der Kommission bzw. ihrer Ad-hoc-<br />
Arbeitsgruppen wurden Bewertungskonzeptionen entwikkelt,<br />
Stoffe beurteilt und die Ergebnisse in den Kommissionsmitteilungen<br />
“MAK- und BAT-Werte-Liste” der Jahre 2002<br />
und 2003 - jeweils in deutschen als auch englischen Fassungen<br />
- veröffentlicht [1,2]. In den Broschüren sind mehr als<br />
160 Änderungen und Neuaufnahmen pro Arbeitsjahr dokumentiert.<br />
Für jede Neuaufnahme und Änderung wurden<br />
detaillierte wissenschaftliche Begründungen erarbeitet.<br />
Deren Veröffentlichung erfolgte in der Monographiensammlung<br />
“Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe - Toxikologisch-arbeitsmedizinische<br />
Begründungen von MAK-Werten”<br />
(Herausgeber: H. Greim) der Jahre 2002 und 2003 (Lieferungen<br />
34 bis 37) mit jeweils 400-500 Druckseiten pro<br />
Lieferung [3]. In den “MAK- und BAT-Werte-Liste(n) 2002”<br />
und “.. 2003” sind die jeweils auf den neuesten Stand<br />
gebrachten Leitlinien dargelegt, wie die Kommission bei<br />
ihren Bewertungen, insbesondere der Ableitung von MAK-<br />
Werten vorgeht. In den einschlägigen Kapiteln sind die<br />
Kriterien für die Einstufung von Stoffen in folgende Wirk-<br />
M019<br />
Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
kategorien festgeschrieben: Kanzerogenität,Keimzellmutagenität,<br />
Fruchtschädigung, Sensibilisierung, Hautresorption,<br />
zulässige Kurzzeit-Überschreitung. Erwähnenswert ist die<br />
Neufassung des Kapitels “Aerosole” hinsichtlich der wirkungsbestimmenden<br />
Eigenschaften der Aerosole, ihrer Deposition<br />
und Clearance in den Atmungsorganen, ihrer wirkungsbezogenen<br />
Messung sowie der Festlegung von Fraktionen<br />
für die Messtechnik [2].<br />
Bei der Überprüfung von Arbeitsstoffen auf krebserzeugende<br />
Wirkung wurden folgende Stoffe als Kanzerogene<br />
erkannt oder neu bewertet und aufgrund ihres Wirkmodus<br />
und ihrer Wirkungsstärke in eine der fünf Kanzerogen-Kategorien<br />
eingestuft [1-5]:<br />
Kategorie 1, d. h. erwiesenermaßen krebserzeugend bei<br />
Menschen: Arsen und seine anorganischen Verbindungen;<br />
Beryllium, Benzol (Jahresproduktion in Deutschland: 2.3<br />
Mio t; s. a.[7]), Vinylchlorid.<br />
Kategorie 2, d. h. eindeutig krebserzeugend beim Versuchstier,<br />
daher beim Menschen als krebserzeugend anzusehen:<br />
2-Nitrotoluol, Ochratoxin A, 1-Chlor-2,3-epoxypropan;<br />
Kategorie 3A. Diese Kategorie ist Stoffen vorbehalten, deren<br />
krebserzeugender Wirkmechanismus zwar bekannt ist, für<br />
die jedoch Daten zur Ableitung eines MAK-Wertes fehlen.<br />
Eingestuft wurde Vinylacetat (Jahresproduktion: ca. 4<br />
Mio t).<br />
Kategorie 3B. Stoffe, die im Verdacht stehen, Krebs zu<br />
erzeugen: Stickstoffdioxid (der bisherige MAK-Wert<br />
wurde ausgesetzt); Bromchlormethan, Glutardialdehyd:<br />
empfohlener Momentanwert, der nicht überschritten<br />
werden darf: 0.8 mg/m3 ; Rhodium; chlorierte Biphenyle;<br />
Chlorparaffine, N,N’,N’’-Triethylhexahydro-<br />
1,3,5-triazin.<br />
Kategorie 4. Kanzerogene, bei denen gentoxische Effekte<br />
keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen: Di(2ethylhexyl)phthalat<br />
(Zusatz für Kunststoffe; Jahresproduktion<br />
ca. 3 Mio t; ubiquitäres Vorkommen): MAK-Wert:<br />
10 mg/m3 ; Tetrahydrofuran: MAK-Wert: 150 mg/m3 .<br />
Beispiele für Stoffe, für die nach intensiver Prüfung keine<br />
MAK-Werte aufgestellt werden konnten: chlorierte Diphenyloxide;<br />
Ethylhexansäure; Dicyandiamid; Resorcin; Nikotin;<br />
Osmiumtetroxid; Wolfram und seine Verbindungen;<br />
Tellur.<br />
Bewertung von Kontrolldaten bei Kanzerogenitätsexperimenten.<br />
Es wurden Grundsätze erarbeitet, nach denen die MAK-<br />
Kommission Kontrolldaten von Kanzerogenitätsversuchen,<br />
insbesondere sog. historische Kontrollen bei Tierversuchen<br />
bewertet. Grund für diese Klarstellung ist die steigende<br />
Tendenz, ein aktuelles Tierversuchsergebnis im Licht älterer<br />
Kontrolldaten zu interpretieren. So haben namhafte Industrieunternehmen<br />
(aber auch das NATIONAL CANCER INSTITUTE)<br />
Datenbanken z. B. über Häufigkeiten von Spontantumoren<br />
bei Kontrolltieren angelegt. Da diese Kontrolldaten oft nach<br />
Gutdünken zur Evaluierung expositionsbedingter kanzerogener<br />
Effekte herangezogen werden, hat die MAK-Kommission<br />
nunmehr Leitlinien publiziert, wann überhaupt historische<br />
Kontrolldaten in Betracht gezogen werden können und<br />
welche Bedingungen erfüllt sein müssen (z. B. Zeitfenster,