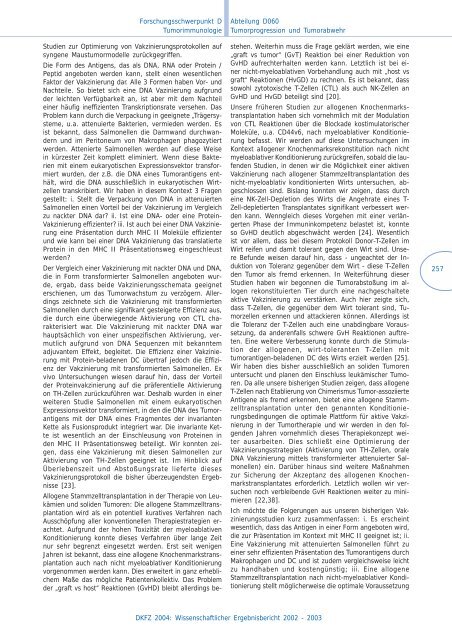MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forschungsschwerpunkt D<br />
Tumorimmunologie<br />
Studien zur Optimierung von Vakzinierungsprotokollen auf<br />
syngene Maustumormodelle zurückgegriffen.<br />
Die Form des Antigens, das als DNA, RNA oder Protein /<br />
Peptid angeboten werden kann, stellt einen wesentlichen<br />
Faktor der Vakzinierung dar. Alle 3 Formen haben Vor- und<br />
Nachteile. So bietet sich eine DNA Vazinierung aufgrund<br />
der leichten Verfügbarkeit an, ist aber mit dem Nachteil<br />
einer häufig ineffizienten Transkriptionsrate versehen. Das<br />
Problem kann durch die Verpackung in geeignete „Trägersysteme,<br />
u.a. attenuierte Bakterien, vermieden werden. Es<br />
ist bekannt, dass Salmonellen die Darmwand durchwandern<br />
und im Peritoneum von Makrophagen phagozytiert<br />
werden. Attenierte Salmonellen werden auf diese Weise<br />
in kürzester Zeit komplett eliminiert. Wenn diese Bakterien<br />
mit einem eukaryotischen Expressionsvektor transformiert<br />
wurden, der z.B. die DNA eines Tumorantigens enthält,<br />
wird die DNA ausschließlich in eukaryotischen Wirtzellen<br />
transkribiert. Wir haben in diesem Kontext 3 Fragen<br />
gestellt: i. Stellt die Verpackung von DNA in attenuierten<br />
Salmonellen einen Vorteil bei der Vakzinierung im Vergleich<br />
zu nackter DNA dar? ii. Ist eine DNA- oder eine Protein-<br />
Vakzinierung effizienter? iii. Ist auch bei einer DNA Vakzinierung<br />
eine Präsentation durch MHC II Moleküle effizienter<br />
und wie kann bei einer DNA Vakzinierung das translatierte<br />
Protein in den MHC II Präsentationsweg eingeschleust<br />
werden?<br />
Der Vergleich einer Vakzinierung mit nackter DNA und DNA,<br />
die in Form transformierter Salmonellen angeboten wurde,<br />
ergab, dass beide Vakzinierungsschemata geeignet<br />
erschienen, um das Tumorwachstum zu verzögern. Allerdings<br />
zeichnete sich die Vakzinierung mit transformierten<br />
Salmonellen durch eine signifikant gesteigerte Effizienz aus,<br />
die durch eine überwiegende Aktivierung von CTL charakterisiert<br />
war. Die Vakzinierung mit nackter DNA war<br />
hauptsächlich von einer unspezifischen Aktivierung, vermutlich<br />
aufgrund von DNA Sequenzen mit bekanntem<br />
adjuvantem Effekt, begleitet. Die Effizienz einer Vakzinierung<br />
mit Protein-beladenen DC übertraf jedoch die Effizienz<br />
der Vakzinierung mit transformierten Salmonellen. Ex<br />
vivo Untersuchungen wiesen darauf hin, dass der Vorteil<br />
der Proteinvakzinierung auf die präferentielle Aktivierung<br />
on TH-Zellen zurückzuführen war. Deshalb wurden in einer<br />
weiteren Studie Salmonellen mit einem eukaryotischen<br />
Expressionsvektor transformiert, in den die DNA des Tumorantigens<br />
mit der DNA eines Fragmentes der invarianten<br />
Kette als Fusionsprodukt integriert war. Die invariante Kette<br />
ist wesentlich an der Einschleusung von Proteinen in<br />
den MHC II Präsentationsweg beteiligt. Wir konnten zeigen,<br />
dass eine Vakzinierung mit diesen Salmonellen zur<br />
Aktivierung von TH-Zellen geeignet ist. Im Hinblick auf<br />
Überlebenszeit und Abstoßungsrate lieferte dieses<br />
Vakzinierungsprotokoll die bisher überzeugendsten Ergebnisse<br />
[23].<br />
Allogene Stammzelltransplantation in der Therapie von Leukämien<br />
und soliden Tumoren: Die allogene Stammzelltransplantation<br />
wird als ein potentiell kuratives Verfahren nach<br />
Ausschöpfung aller konventionellen Therapiestrategien erachtet.<br />
Aufgrund der hohen Toxizität der myeloablativen<br />
Konditionierung konnte dieses Verfahren über lange Zeit<br />
nur sehr begrenzt eingesetzt werden. Erst seit wenigen<br />
Jahren ist bekannt, dass eine allogene Knochenmarkstransplantation<br />
auch nach nicht myeloablativer Konditionierung<br />
vorgenommen werden kann. Dies erweitert in ganz erheblichem<br />
Maße das mögliche Patientenkollektiv. Das Problem<br />
der „graft vs host“ Reaktionen (GvHD) bleibt allerdings be-<br />
Abteilung D060<br />
Tumorprogression und Tumorabwehr<br />
stehen. Weiterhin muss die Frage geklärt werden, wie eine<br />
„graft vs tumor“ (GvT) Reaktion bei einer Reduktion von<br />
GvHD aufrechterhalten werden kann. Letztlich ist bei einer<br />
nicht-myeloablativen Vorbehandlung auch mit „host vs<br />
graft“ Reaktionen (HvGD) zu rechnen. Es ist bekannt, dass<br />
sowohl zytotoxische T-Zellen (CTL) als auch NK-Zellen an<br />
GvHD und HvGD beteiligt sind [20].<br />
Unsere früheren Studien zur allogenen Knochenmarkstransplantation<br />
haben sich vornehmlich mit der Modulation<br />
von CTL Reaktionen über die Blockade kostimulatorischer<br />
Moleküle, u.a. CD44v6, nach myeloablativer Konditionierung<br />
befasst. Wir werden auf diese Untersuchungen im<br />
Kontext allogener Knochenmarksrekonstitution nach nicht<br />
myeloablativer Konditionierung zurückgreifen, sobald die laufenden<br />
Studien, in denen wir die Möglichkeit einer aktiven<br />
Vakzinierung nach allogener Stammzelltransplantation des<br />
nicht-myeloablativ konditionierten Wirts untersuchen, abgeschlossen<br />
sind. Bislang konnten wir zeigen, dass durch<br />
eine NK-Zell-Depletion des Wirts die Angehrate eines T-<br />
Zell-depletierten Transplantates signifikant verbessert werden<br />
kann. Wenngleich dieses Vorgehen mit einer verlängerten<br />
Phase der Immuninkompetenz belastet ist, konnte<br />
so GvHD deutlich abgeschwächt werden [24]. Wesentlich<br />
ist vor allem, dass bei diesem Protokoll Donor-T-Zellen im<br />
Wirt reifen und damit tolerant gegen den Wirt sind. Unsere<br />
Befunde weisen darauf hin, dass - ungeachtet der Induktion<br />
von Toleranz gegenüber dem Wirt - diese T-Zellen<br />
den Tumor als fremd erkennen. In Weiterführung dieser<br />
Studien haben wir begonnen die Tumorabstoßung im allogen<br />
rekonstituierten Tier durch eine nachgeschaltete<br />
aktive Vakzinierung zu verstärken. Auch hier zeigte sich,<br />
dass T-Zellen, die gegenüber dem Wirt tolerant sind, Tumorzellen<br />
erkennen und attackieren können. Allerdings ist<br />
die Toleranz der T-Zellen auch eine unabdingbare Voraussetzung,<br />
da anderenfalls schwere GvH Reaktionen auftreten.<br />
Eine weitere Verbesserung konnte durch die Stimulation<br />
der allogenen, wirt-toleranten T-Zellen mit<br />
tumorantigen-beladenen DC des Wirts erzielt werden [25].<br />
Wir haben dies bisher ausschließlich an soliden Tumoren<br />
untersucht und planen den Einschluss leukämischer Tumoren.<br />
Da alle unsere bisherigen Studien zeigen, dass allogene<br />
T-Zellen nach Etablierung von Chimerismus Tumor-assoziierte<br />
Antigene als fremd erkennen, bietet eine allogene Stammzelltransplantation<br />
unter den genannten Konditionierungsbedingungen<br />
die optimale Plattform für aktive Vakzinierung<br />
in der Tumortherapie und wir werden in den folgenden<br />
Jahren vornehmlich dieses Therapiekonzept weiter<br />
ausarbeiten. Dies schließt eine Optimierung der<br />
Vakzinierungsstrategien (Aktivierung von TH-Zellen, orale<br />
DNA Vakzinierung mittels transformierter attenuierter Salmonellen)<br />
ein. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen<br />
zur Sicherung der Akzeptanz des allogenen Knochenmarkstransplantates<br />
erforderlich. Letztlich wollen wir versuchen<br />
noch verbleibende GvH Reaktionen weiter zu minimieren<br />
[22,38].<br />
Ich möchte die Folgerungen aus unseren bisherigen Vakzinierungsstudien<br />
kurz zusammenfassen: i. Es erscheint<br />
wesentlich, dass das Antigen in einer Form angeboten wird,<br />
die zur Präsentation im Kontext mit MHC II geeignet ist; ii.<br />
Eine Vakzinierung mit attenuierten Salmonellen führt zu<br />
einer sehr effizienten Präsentation des Tumorantigens durch<br />
Makrophagen und DC und ist zudem vergleichsweise leicht<br />
zu handhaben und kostengünstig; iii. Eine allogene<br />
Stammzelltransplantation nach nicht-myeloablativer Konditionierung<br />
stellt möglicherweise die optimale Voraussetzung<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
257