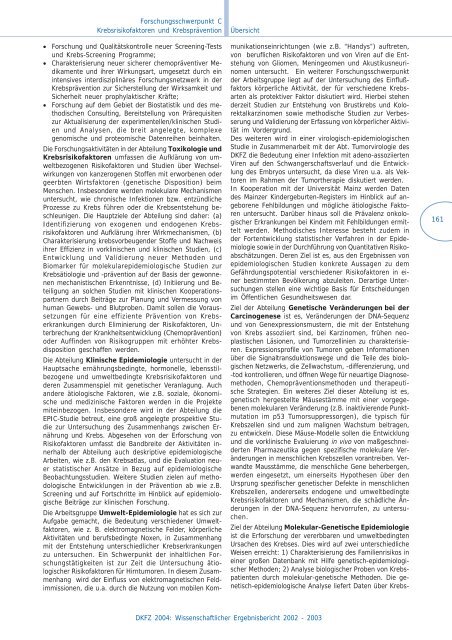MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention Übersicht<br />
• Forschung und Qualitätskontrolle neuer Screening-Tests<br />
und Krebs-Screening Programme;<br />
• Charakterisierung neuer sicherer chemopräventiver Medikamente<br />
und ihrer Wirkungsart, umgesetzt durch ein<br />
intensives interdisziplinäres Forschungsnetzwerk in der<br />
Krebsprävention zur Sicherstellung der Wirksamkeit und<br />
Sicherheit neuer prophylaktischer Kräfte;<br />
• Forschung auf dem Gebiet der Biostatistik und des methodischen<br />
Consulting, Bereitstellung von Prärequisiten<br />
zur Aktualisierung der experimentellen/klinischen Studien<br />
und Analysen, die breit angelegte, komplexe<br />
genomische und proteomische Datenreihen beinhalten.<br />
Die Forschungsaktivitäten in der Abteilung Toxikologie und<br />
Krebsrisikofaktoren umfassen die Aufklärung von umweltbezogenen<br />
Risikofaktoren und Studien über Wechselwirkungen<br />
von kanzerogenen Stoffen mit erworbenen oder<br />
geerbten Wirtsfaktoren (genetische Disposition) beim<br />
Menschen. Insbesondere werden molekulare Mechanismen<br />
untersucht, wie chronische Infektionen bzw. entzündliche<br />
Prozesse zu Krebs führen oder die Krebsentstehung beschleunigen.<br />
Die Hauptziele der Abteilung sind daher: (a)<br />
Identifizierung von exogenen und endogenen Krebsrisikofaktoren<br />
und Aufklärung ihrer Wirkmechanismen, (b)<br />
Charakterisierung krebsvorbeugender Stoffe und Nachweis<br />
ihrer Effizienz in vorklinischen und klinischen Studien, (c)<br />
Entwicklung und Validierung neuer Methoden und<br />
Biomarker für molekularepidemiologische Studien zur<br />
Krebsätiologie und -prävention auf der Basis der gewonnenen<br />
mechanistischen Erkenntnisse, (d) Initiierung und Beteiligung<br />
an solchen Studien mit klinischen Kooperationspartnern<br />
durch Beiträge zur Planung und Vermessung von<br />
human Gewebs- und Blutproben. Damit sollen die Voraussetzungen<br />
für eine effiziente Prävention von Krebserkrankungen<br />
durch Eliminierung der Risikofaktoren, Unterbrechung<br />
der Krankheitsentwicklung (Chemoprävention)<br />
oder Auffinden von Risikogruppen mit erhöhter Krebsdisposition<br />
geschaffen werden.<br />
Die Abteilung Klinische Epidemiologie untersucht in der<br />
Hauptsache ernährungsbedingte, hormonelle, lebensstilbezogene<br />
und umweltbedingte Krebsrisikofaktoren und<br />
deren Zusammenspiel mit genetischer Veranlagung. Auch<br />
andere ätiologische Faktoren, wie z.B. soziale, ökonomische<br />
und medizinische Faktoren werden in die Projekte<br />
miteinbezogen. Insbesondere wird in der Abteilung die<br />
EPIC-Studie betreut, eine groß angelegte prospektive Studie<br />
zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Ernährung<br />
und Krebs. Abgesehen von der Erforschung von<br />
Risikofaktoren umfasst die Bandbreite der Aktivitäten innerhalb<br />
der Abteilung auch deskriptive epidemiologische<br />
Arbeiten, wie z.B. den Krebsatlas, und die Evaluation neuer<br />
statistischer Ansätze in Bezug auf epidemiologische<br />
Beobachtungsstudien. Weitere Studien zielen auf methodologische<br />
Entwicklungen in der Prävention ab wie z.B.<br />
Screening und auf Fortschritte im Hinblick auf epidemiologische<br />
Beiträge zur klinischen Forschung.<br />
Die Arbeitsgruppe Umwelt-Epidemiologie hat es sich zur<br />
Aufgabe gemacht, die Bedeutung verschiedener Umweltfaktoren,<br />
wie z. B. elektromagnetische Felder, körperliche<br />
Aktivitäten und berufsbedingte Noxen, in Zusammenhang<br />
mit der Entstehung unterschiedlicher Krebserkrankungen<br />
zu untersuchen. Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Forschungstätigkeiten<br />
ist zur Zeit die Untersuchung ätiologischer<br />
Risikofaktoren für Hirntumoren. In diesem Zusammenhang<br />
wird der Einfluss von elektromagnetischen Feldimmissionen,<br />
die u.a. durch die Nutzung von mobilen Kom-<br />
munikationseinrichtungen (wie z.B. “Handys”) auftreten,<br />
von beruflichen Risikofaktoren und von Viren auf die Entstehung<br />
von Gliomen, Meningeomen und Akustikusneurinomen<br />
untersucht. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt<br />
der Arbeitsgruppe liegt auf der Untersuchung des Einflußfaktors<br />
körperliche Aktivität, der für verschiedene Krebsarten<br />
als protektiver Faktor diskutiert wird. Hierbei stehen<br />
derzeit Studien zur Entstehung von Brustkrebs und Kolorektalkarzinomen<br />
sowie methodische Studien zur Verbesserung<br />
und Validierung der Erfassung von körperlicher Aktivität<br />
im Vordergrund.<br />
Des weiteren wird in einer virologisch-epidemiologischen<br />
Studie in Zusammenarbeit mit der Abt. Tumorvirologie des<br />
DKFZ die Bedeutung einer Infektion mit adeno-assoziierten<br />
Viren auf den Schwangerschaftsverlauf und die Entwicklung<br />
des Embryos untersucht, da diese Viren u.a. als Vektoren<br />
im Rahmen der Tumortherapie diskutiert werden.<br />
In Kooperation mit der Universität Mainz werden Daten<br />
des Mainzer Kindergeburten-Registers im Hinblick auf angeborene<br />
Fehlbildungen und mögliche ätiologische Faktoren<br />
untersucht. Darüber hinaus soll die Prävalenz onkologischer<br />
Erkrankungen bei Kindern mit Fehlbildungen ermittelt<br />
werden. Methodisches Interesse besteht zudem in<br />
der Fortentwicklung statistischer Verfahren in der Epidemiologie<br />
sowie in der Durchführung von Quantitativen Risikoabschätzungen.<br />
Deren Ziel ist es, aus den Ergebnissen von<br />
epidemiologischen Studien konkrete Aussagen zu dem<br />
Gefährdungspotential verschiedener Risikofaktoren in einer<br />
bestimmten Bevölkerung abzuleiten. Derartige Untersuchungen<br />
stellen eine wichtige Basis für Entscheidungen<br />
im Öffentlichen Gesundheitswesen dar.<br />
Ziel der Abteilung Genetische Veränderungen bei der<br />
Carcinogenese ist es, Veränderungen der DNA-Sequenz<br />
und von Genexpressionsmustern, die mit der Entstehung<br />
von Krebs assoziiert sind, bei Karzinomen, frühen neoplastischen<br />
Läsionen, und Tumorzellinien zu charakterisieren.<br />
Expressionsprofile von Tumoren geben Informationen<br />
über die Signaltransduktionswege und die Teile des biologischen<br />
Netzwerks, die Zellwachstum, -differenzierung, und<br />
-tod kontrollieren, und öffnen Wege für neuartige Diagnosemethoden,<br />
Chemopräventionsmethoden und therapeutische<br />
Strategien. Ein weiteres Ziel dieser Abteilung ist es,<br />
genetisch hergestellte Mäusestämme mit einer vorgegebenen<br />
molekularen Veränderung (z.B. inaktivierende Punktmutation<br />
im p53 Tumorsuppressorgen), die typisch für<br />
Krebszellen sind und zum malignen Wachstum beitragen,<br />
zu entwickeln. Diese Mäuse-Modelle sollen die Entwicklung<br />
und die vorklinische Evaluierung in vivo von maßgeschneiderten<br />
Pharmazeutika gegen spezifische molekulare Veränderungen<br />
in menschlichen Krebszellen vorantreiben. Verwandte<br />
Mausstämme, die menschliche Gene beherbergen,<br />
werden eingesetzt, um einerseits Hypothesen über den<br />
Ursprung spezifischer genetischer Defekte in menschlichen<br />
Krebszellen, andererseits endogene und umweltbedingte<br />
Krebsrisikofaktoren und Mechanismen, die schädliche Änderungen<br />
in der DNA-Sequenz hervorrufen, zu untersuchen.<br />
Ziel der Abteilung Molekular-Genetische Epidemiologie<br />
ist die Erforschung der vererbbaren und umweltbedingten<br />
Ursachen des Krebses. Dies wird auf zwei unterschiedliche<br />
Weisen erreicht: 1) Charakterisierung des Familienrisikos in<br />
einer großen Datenbank mit Hilfe genetisch-epidemiologischer<br />
Methoden; 2) Analyse biologischer Proben von Krebspatienten<br />
durch molekular-genetische Methoden. Die genetisch-epidemiologische<br />
Analyse liefert Daten über Krebs-<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
161