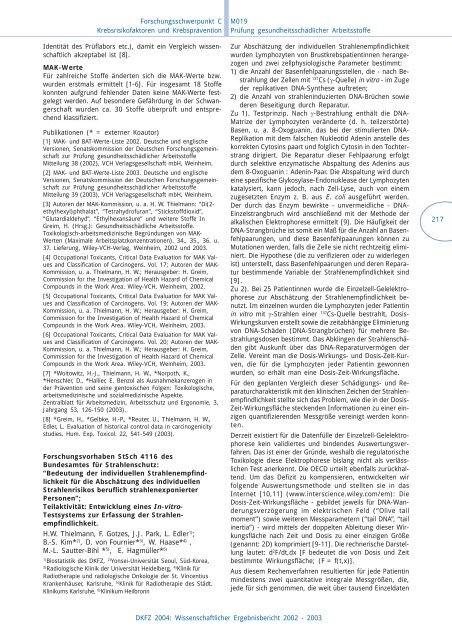MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention<br />
Identität des Prüflabors etc.), damit ein Vergleich wissenschaftlich<br />
akzeptabel ist [8].<br />
MAK-Werte<br />
Für zahlreiche Stoffe änderten sich die MAK-Werte bzw.<br />
wurden erstmals ermittelt [1-6]. Für insgesamt 18 Stoffe<br />
konnten aufgrund fehlender Daten keine MAK-Werte festgelegt<br />
werden. Auf besondere Gefährdung in der Schwangerschaft<br />
wurden ca. 30 Stoffe überprüft und entsprechend<br />
klassifiziert.<br />
Publikationen (* = externer Koautor)<br />
[1] MAK- und BAT-Werte-Liste 2002. Deutsche und englische<br />
Versionen, Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe<br />
Mitteilung 38 (2002), VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim.<br />
[2] MAK- und BAT-Werte-Liste 2003. Deutsche und englische<br />
Versionen, Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe<br />
Mitteilung 39 (2003), VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim.<br />
[3] Autoren der MAK-Kommission, u. a. H. W. Thielmann: “Di(2ethylhexyl)phthalat”,<br />
“Tetrahydrofuran”, “Stickstoffdioxid”,<br />
“Glutardialdehyd”, “Ethylhexansäure” und weitere Stoffe In<br />
Greim, H. (Hrsg.): Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe.<br />
Toxikologisch-arbeitsmedizinische Begründungen von MAK-<br />
Werten (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen). 34., 35., 36. u.<br />
37. Lieferung, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 2002 und 2003.<br />
[4] Occupational Toxicants, Critical Data Evaluation for MAK Values<br />
and Classification of Carcinogens. Vol. 17; Autoren der MAK-<br />
Kommission, u. a. Thielmann, H. W.; Herausgeber: H. Greim,<br />
Commission for the Investigation of Health Hazard of Chemical<br />
Compounds in the Work Area. Wiley-VCH, Weinheim, 2002.<br />
[5] Occupational Toxicants, Critical Data Evaluation for MAK Values<br />
and Classification of Carcinogens. Vol. 19; Autoren der MAK-<br />
Kommission, u. a. Thielmann, H. W.; Herausgeber: H. Greim,<br />
Commission for the Investigation of Health Hazard of Chemical<br />
Compounds in the Work Area. Wiley-VCH, Weinheim, 2003.<br />
[6] Occupational Toxicants, Critical Data Evaluation for MAK Values<br />
and Classification of Carcinogens. Vol. 20; Autoren der MAK-<br />
Kommission, u. a. Thielmann, H. W.; Herausgeber: H. Greim,<br />
Commission for the Investigation of Health Hazard of Chemical<br />
Compounds in the Work Area. Wiley-VCH, Weinheim, 2003.<br />
[7] *Woitowitz, H.-J., Thielmann, H. W., *Norpoth, K.,<br />
*Henschler, D., *Hallier, E. Benzol als Ausnahmekanzerogen in<br />
der Prävention und seine gentoxischen Folgen: Toxikologische,<br />
arbeitsmedizinische und sozialmedizinische Aspekte.<br />
Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 3,<br />
Jahrgang 53, 126-150 (2003).<br />
[8] *Greim, H., *Gelbke, H.-P., *Reuter, U., Thielmann, H. W.,<br />
Edler, L. Evaluation of historical control data in carcinogenicity<br />
studies. Hum. Exp. Toxicol. 22, 541-549 (2003).<br />
Forschungsvorhaben StSch 4116 des<br />
Bundesamtes für Strahlenschutz:<br />
“Bedeutung der individuellen Strahlenempfindlichkeit<br />
für die Abschätzung des individuellen<br />
Strahlenrisikos beruflich strahlenexponierter<br />
Personen”;<br />
Teilaktivität: Entwicklung eines In-vitro-<br />
Testsystems zur Erfassung der Strahlenempfindlichkeit.<br />
H.W. Thielmann, F. Gotzes, J.J. Park, L. Edler1) ;<br />
B.-S. Kim* 2) , D. von Fournier* 3) , W. Haase* 4) ,<br />
M.-L. Sautter-Bihl * 5) , E. Hagmüller* 6)<br />
1) Biostatistik des DKFZ, 2) Yonsei-Universität Seoul, Süd-Korea,<br />
3) Radiologische Klinik der Universität Heidelberg, 4) Klinik für<br />
Radiotherapie und radiologische Onkologie der St. Vincentius<br />
Krankenhäuser, Karlsruhe, 5) Klinik für Radiotherapie des Städt.<br />
Klinikums Karlsruhe, 6) Klinikum Heilbronn<br />
M019<br />
Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe<br />
Zur Abschätzung der individuellen Strahlenempfindlichkeit<br />
wurden Lymphozyten von Brustkrebspatientinnen herangezogen<br />
und zwei zellphysiologische Parameter bestimmt:<br />
1) die Anzahl der Basenfehlpaarungsstellen, die - nach Bestrahlung<br />
der Zellen mit 137Cs (γ-Quelle) in vitro - im Zuge<br />
der replikativen DNA-Synthese auftreten;<br />
2) die Anzahl von strahleninduzierten DNA-Brüchen sowie<br />
deren Beseitigung durch Reparatur.<br />
Zu 1). Testprinzip. Nach γ-Bestrahlung enthält die DNA-<br />
Matrize der Lymphozyten veränderte (d. h. teilzerstörte)<br />
Basen, u. a. 8-Oxoguanin, das bei der stimulierten DNA-<br />
Replikation mit dem falschen Nukleotid Adenin anstelle des<br />
korrekten Cytosins paart und folglich Cytosin in den Tochterstrang<br />
dirigiert. Die Reparatur dieser Fehlpaarung erfolgt<br />
durch selektive enzymatische Abspaltung des Adenins aus<br />
dem 8-Oxoguanin : Adenin-Paar. Die Abspaltung wird durch<br />
eine spezifische Glykosylase-Endonuklease der Lymphozyten<br />
katalysiert, kann jedoch, nach Zell-Lyse, auch von einem<br />
zugesetzten Enzym z. B. aus E. coli ausgeführt werden.<br />
Der durch das Enzym bewirkte - unvermeidliche - DNA-<br />
Einzelstrangbruch wird anschließend mit der Methode der<br />
alkalischen Elektrophorese ermittelt [9]. Die Häufigkeit der<br />
DNA-Strangbrüche ist somit ein Maß für die Anzahl an Basenfehlpaarungen,<br />
und diese Basenfehlpaarungen können zu<br />
Mutationen werden, falls die Zelle sie nicht rechtzeitig eliminiert.<br />
Die Hypothese (die zu verifizieren oder zu widerlegen<br />
ist) unterstellt, dass Basenfehlpaarungen und deren Reparatur<br />
bestimmende Variable der Strahlenempfindlichkeit sind<br />
[9].<br />
Zu 2). Bei 25 Patientinnen wurde die Einzelzell-Gelelektrophorese<br />
zur Abschätzung der Strahlenempfindlichkeit benutzt.<br />
Im einzelnen wurden die Lymphozyten jeder Patientin<br />
in vitro mit γ-Strahlen einer 137Cs-Quelle bestrahlt, Dosis-<br />
Wirkungskurven erstellt sowie die zeitabhängige Eliminierung<br />
von DNA-Schäden (DNA-Strangbrüchen) für mehrere Bestrahlungsdosen<br />
bestimmt. Das Abklingen der Strahlenschäden<br />
gibt Auskunft über das DNA-Reparaturvermögen der<br />
Zelle. Vereint man die Dosis-Wirkungs- und Dosis-Zeit-Kurven,<br />
die für die Lymphozyten jeder Patientin gewonnen<br />
wurden, so erhält man eine Dosis-Zeit-Wirkungsfläche.<br />
Für den geplanten Vergleich dieser Schädigungs- und Reparaturcharakteristik<br />
mit den klinischen Zeichen der Strahlenempfindlichkeit<br />
stellte sich das Problem, wie die in der Dosis-<br />
Zeit-Wirkungsfläche steckenden Informationen zu einer einzigen<br />
quantifizierenden Messgröße vereinigt werden konnten.<br />
Derzeit existiert für die Datenfülle der Einzelzell-Gelelektrophorese<br />
kein validiertes und bindendes Auswertungsverfahren.<br />
Das ist einer der Gründe, weshalb die regulatorische<br />
Toxikologie diese Elektrophorese bislang nicht als verlässlichen<br />
Test anerkennt. Die OECD urteilt ebenfalls zurückhaltend.<br />
Um das Defizit zu kompensieren, entwickelten wir<br />
folgende Auswertungsmethode und stellten sie in das<br />
Internet [10,11] (www.interscience.wiley.com/em): Die<br />
Dosis-Zeit-Wirkungsfläche - gebildet jeweils für DNA-Wanderungsverzögerung<br />
im elektrischen Feld (“Olive tail<br />
moment”) sowie weiteren Messparametern (“tail DNA”, “tail<br />
inertia”) - wird mittels der doppelten Ableitung dieser Wirkungsfläche<br />
nach Zeit und Dosis zu einer einzigen Größe<br />
(genannt: 2D) komprimiert [9-11]. Die rechnerische Darstellung<br />
lautet: d2F/dt,dx [F bedeutet die von Dosis und Zeit<br />
bestimmte Wirkungsfläche; (F = f(t,x)].<br />
Aus diesem Rechenverfahren resultierten für jede Patientin<br />
mindestens zwei quantitative integrale Messgrößen, die,<br />
jede für sich genommen, die weit über tausend Einzeldaten<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
217