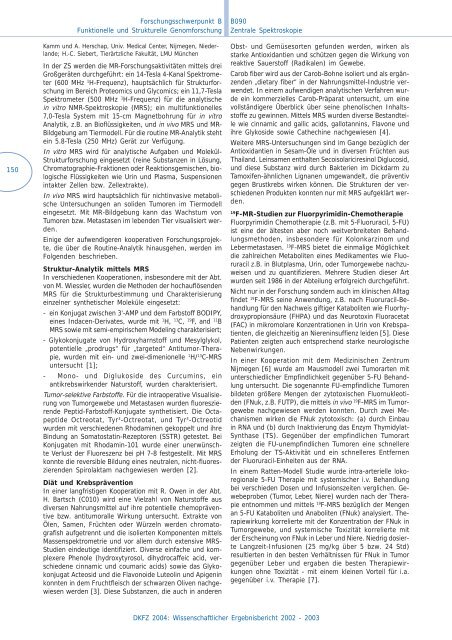MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
150<br />
Forschungsschwerpunkt B<br />
Funktionelle und Strukturelle Genomforschung<br />
Kamm und A. Herschap, Univ. Medical Center, Nijmegen, Niederlande;<br />
H.-C. Siebert, Tierärtzliche Fakultät, LMU München<br />
In der ZS werden die MR-Forschungsaktivitäten mittels drei<br />
Großgeräten durchgeführt: ein 14-Tesla 4-Kanal Spektrometer<br />
(600 MHz 1H-Frequenz), hauptsächlich für Strukturforschung<br />
im Bereich Proteomics und Glycomics; ein 11,7-Tesla<br />
Spektrometer (500 MHz 1H-Frequenz) für die analytische<br />
in vitro NMR-Spektroskopie (MRS); ein multifunktionelles<br />
7,0-Tesla System mit 15-cm Magnetbohrung für in vitro<br />
Analytik, z.B. an Bioflüssigkeiten, und in vivo MRS und MR-<br />
Bildgebung am Tiermodell. Für die routine MR-Analytik steht<br />
ein 5.8-Tesla (250 MHz) Gerät zur Verfügung.<br />
In vitro MRS wird für analytische Aufgaben und Molekül-<br />
Strukturforschung eingesetzt (reine Substanzen in Lösung,<br />
Chromatographie-Fraktionen oder Reaktionsgemischen, biologische<br />
Flüssigkeiten wie Urin und Plasma, Suspensionen<br />
intakter Zellen bzw. Zellextrakte).<br />
In vivo MRS wird hauptsächlich für nichtinvasive metabolische<br />
Untersuchungen an soliden Tumoren im Tiermodell<br />
eingesetzt. Mit MR-Bildgebung kann das Wachstum von<br />
Tumoren bzw. Metastasen im lebenden Tier visualisiert werden.<br />
Einige der aufwendigeren kooperativen Forschungsprojekte,<br />
die über die Routine-Analytik hinausgehen, werden im<br />
Folgenden beschrieben.<br />
Struktur-Analytik mittels MRS<br />
In verschiedenen Kooperationen, insbesondere mit der Abt.<br />
von M. Wiessler, wurden die Methoden der hochauflösenden<br />
MRS für die Strukturbestimmung und Charakterisierung<br />
einzelner synthetischer Moleküle eingesetzt:<br />
- ein Konjugat zwischen 3'-AMP und dem Farbstoff BODIPY,<br />
eines Indacen-Derivates, wurde mit 1H, 13C, 19F, and 11B MRS sowie mit semi-empirischem Modeling charakterisiert;<br />
- Glykokonjugate von Hydroxyharnstoff und Mesylglykol,<br />
potentielle „prodrugs“ für „targeted“ Antitumor-Therapie,<br />
wurden mit ein- und zwei-dimenionelle 1H/ 13C-MRS untersucht [1];<br />
- Mono- und Diglukoside des Curcumins, ein<br />
antikrebswirkender Naturstoff, wurden charakterisiert.<br />
Tumor-selektive Farbstoffe. Für die intraoperative Visualisierung<br />
von Tumorgewebe und Metastasen wurden fluoreszierende<br />
Peptid-Farbstoff-Konjugate synthetisiert. Die Octapeptide<br />
Octreotat, Tyr3-Octreotat, und Tyr3-Octreotid wurden mit verschiedenen Rhodaminen gekoppelt und ihre<br />
Bindung an Somatostatin-Rezeptoren (SSTR) getestet. Bei<br />
Konjugaten mit Rhodamin-101 wurde einer unerwünschte<br />
Verlust der Fluoreszenz bei pH 7-8 festgestellt. Mit MRS<br />
konnte die reversible Bildung eines neutralen, nicht-fluoreszierenden<br />
Spirolaktam nachgewiesen werden [2].<br />
Diät und Krebsprävention<br />
In einer langfristigen Kooperation mit R. Owen in der Abt.<br />
H. Bartsch (C010) wird eine Vielzahl von Naturstoffe aus<br />
diversen Nahrungsmittel auf ihre potentielle chemopräventive<br />
bzw. antitumoralle Wirkung untersucht. Extrakte von<br />
Ölen, Samen, Früchten oder Würzeln werden chromatografish<br />
aufgetrennt und die isolierten Komponenten mittels<br />
Massenspektrometrie und vor allem durch extensive MRS-<br />
Studien eindeutige identifiziert. Diverse einfache und komplexere<br />
Phenole (hydroxytyrosol, dihydrocaffeic acid, verschiedene<br />
cinnamic und coumaric acids) sowie das Glykokonjugat<br />
Acteosid und die Flavonoide Luteolin und Apigenin<br />
konnten in dem Fruchtfleisch der schwarzen Oliven nachgewiesen<br />
werden [3]. Diese Substanzen, die auch in anderen<br />
B090<br />
Zentrale Spektroskopie<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Obst- und Gemüsesorten gefunden werden, wirken als<br />
starke Antioxidantien und schützen gegen die Wirkung von<br />
reaktive Sauerstoff (Radikalen) im Gewebe.<br />
Carob fiber wird aus der Carob-Bohne isoliert und als ergänzenden<br />
„dietary fiber“ in der Nahrungsmittel-Industrie verwendet.<br />
In einem aufwendigen analytischen Verfahren wurde<br />
ein kommerzielles Carob-Präparat untersucht, um eine<br />
vollständigere Überblick über seine phenolischen Inhaltsstoffe<br />
zu gewinnen. Mittels MRS wurden diverse Bestandteile<br />
wie cinnamic and gallic acids, gallotannins, Flavone und<br />
ihre Glykoside sowie Cathechine nachgewiesen [4].<br />
Weitere MRS-Untersuchungen sind im Gange bezüglich der<br />
Antioxidantien in Sesam-Öle und in diversen Früchten aus<br />
Thailand. Leinsamen enthalten Secoisolariciresinol Diglucosid,<br />
und diese Substanz wird durch Bakterien im Dickdarm zu<br />
Tamoxifen-ähnlichen Lignanen umgewandelt, die präventiv<br />
gegen Brustkrebs wirken können. Die Strukturen der verschiedenen<br />
Produkten konnten nur mit MRS aufgeklärt werden.<br />
19F-MR-Studien zur Fluorpyrimidin-Chemotherapie<br />
Fluorpyrimidin Chemotherapie (z.B. mit 5-Fluoruracil, 5-FU)<br />
ist eine der ältesten aber noch weitverbreiteten Behandlungsmethoden,<br />
insbesondere für Kolonkarzinom und<br />
Lebermetastasen. 19F-MRS bietet die einmalige Möglichkeit<br />
die zahlreichen Metaboliten eines Medikamentes wie Fluoruracil<br />
z.B. in Blutplasma, Urin, oder Tumorgewebe nachzuweisen<br />
und zu quantifizieren. Mehrere Studien dieser Art<br />
wurden seit 1986 in der Abteilung erfolgreich durchgeführt.<br />
Nicht nur in der Forschung sondern auch im klinischen Alltag<br />
findet 19F-MRS seine Anwendung, z.B. nach Fluoruracil-Behandlung<br />
für den Nachweis giftiger Kataboliten wie Fluorhydroxypropionsäure<br />
(FHPA) und das Neurotoxin Fluoracetat<br />
(FAC) in mikromolare Konzentrationen in Urin von Krebspatienten,<br />
die gleichzeitig an Niereninsuffienz leiden [5]. Diese<br />
Patienten zeigten auch entsprechend starke neurologische<br />
Nebenwirkungen.<br />
In einer Kooperation mit dem Medizinischen Zentrum<br />
Nijmegen [6] wurde am Mausmodell zwei Tumorarten mit<br />
unterschiedlicher Empfindlichkeit gegenüber 5-FU Behandlung<br />
untersucht. Die sogenannte FU-empfindliche Tumoren<br />
bildeten größere Mengen der zytotoxischen Fluornukleotiden<br />
(FNuk, z.B. FUTP), die mittels in vivo 19F-MRS im Tumorgewebe<br />
nachgewiesen werden konnten. Durch zwei Mechanismen<br />
wirken die FNuk zytotoxisch: (a) durch Einbau<br />
in RNA und (b) durch Inaktivierung das Enzym Thymidylat-<br />
Synthase (TS). Gegenüber der empfindlichen Tumorart<br />
zeigten die FU-unempfindlichen Tumoren eine schnellere<br />
Erholung der TS-Aktivität und ein schnelleres Entfernen<br />
der Fluoruracil-Einheiten aus der RNA.<br />
In einem Ratten-Modell Studie wurde intra-arterielle lokoregionale<br />
5-FU Therapie mit systemischer i.v. Behandlung<br />
bei verschieden Dosen und Infusionszeiten verglichen. Gewebeproben<br />
(Tumor, Leber, Niere) wurden nach der Therapie<br />
entnommen und mittels 19F-MRS bezüglich der Mengen<br />
an 5-FU Kataboliten und Anaboliten (FNuk) analysiert. Therapiewirkung<br />
korrelierte mit der Konzentration der FNuk in<br />
Tumorgewebe, und systemische Toxizität korrelierte mit<br />
der Erscheinung von FNuk in Leber und Niere. Niedrig dosierte<br />
Langzeit-Infusionen (25 mg/kg über 5 bzw. 24 Std)<br />
resultierten in den besten Verhältnissen für FNuk in Tumor<br />
gegenüber Leber und ergaben die besten Therapiewirkungen<br />
ohne Toxizität - mit einem kleinen Vorteil für i.a.<br />
gegenüber i.v. Therapie [7].