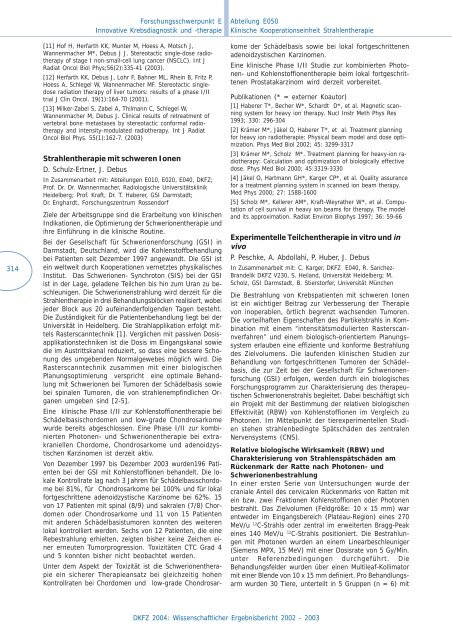MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
314<br />
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
[11] Hof H, Herfarth KK, Munter M, Hoess A, Motsch J,<br />
Wannenmacher M*, Debus J J. Stereotactic single-dose radiotherapy<br />
of stage I non-small-cell lung cancer (NSCLC). Int J<br />
Radiat Oncol Biol Phys;56(2):335-41 (2003).<br />
[12] Herfarth KK, Debus J, Lohr F, Bahner ML, Rhein B, Fritz P,<br />
Hoess A, Schlegel W, Wannenmacher MF. Stereotactic singledose<br />
radiation therapy of liver tumors: results of a phase I/II<br />
trial J Clin Oncol. 19(1):164-70 (2001).<br />
[13] Milker-Zabel S, Zabel A, Thilmann C, Schlegel W,<br />
Wannenmacher M, Debus J. Clinical results of retreatment of<br />
vertebral bone metastases by stereotactic conformal radiotherapy<br />
and intensity-modulated radiotherapy. Int J Radiat<br />
Oncol Biol Phys. 55(1):162-7. (2003)<br />
Strahlentherapie mit schweren Ionen<br />
D. Schulz-Ertner, J. Debus<br />
In Zusammenarbeit mit: Abteilungen E010, E020, E040, DKFZ;<br />
Prof. Dr. Dr. Wannenmacher, Radiologische Universitätsklinik<br />
Heidelberg; Prof. Kraft, Dr. T. Haberer, GSI Darmstadt;<br />
Dr. Enghardt, Forschungszentrum Rossendorf<br />
Ziele der Arbeitsgruppe sind die Erarbeitung von klinischen<br />
Indikationen, die Optimierung der Schwerionentherapie und<br />
ihre Einführung in die klinische Routine.<br />
Bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in<br />
Darmstadt, Deutschland, wird die Kohlenstoffbehandlung<br />
bei Patienten seit Dezember 1997 angewandt. Die GSI ist<br />
ein weltweit durch Kooperationen vernetztes physikalisches<br />
Institut. Das Schwerionen- Synchroton (SIS) bei der GSI<br />
ist in der Lage, geladene Teilchen bis hin zum Uran zu beschleunigen.<br />
Die Schwerionenstrahlung wird derzeit für die<br />
Strahlentherapie in drei Behandlungsblöcken realisiert, wobei<br />
jeder Block aus 20 aufeinanderfolgenden Tagen besteht.<br />
Die Zuständigkeit für die Patientenbehandlung liegt bei der<br />
Universität in Heidelberg. Die Strahlapplikation erfolgt mittels<br />
Rasterscanntechnik [1]. Verglichen mit passiven Dosisapplikationstechniken<br />
ist die Dosis im Eingangskanal sowie<br />
die im Austrittskanal reduziert, so dass eine bessere Schonung<br />
des umgebenden Normalgewebes möglich wird. Die<br />
Rasterscanntechnik zusammen mit einer biologischen<br />
Planungsoptimierung verspricht eine optimale Behandlung<br />
mit Schwerionen bei Tumoren der Schädelbasis sowie<br />
bei spinalen Tumoren, die von strahlenempfindlichen Organen<br />
umgeben sind [2-5].<br />
Eine klinische Phase I/II zur Kohlenstoffionentherapie bei<br />
Schädelbasischordomen und low-grade Chondrosarkome<br />
wurde bereits abgeschlossen. Eine Phase I/II zur kombinierten<br />
Photonen- und Schwerionentherapie bei extrakraniellen<br />
Chordome, Chondrosarkome und adenoidzystischen<br />
Karzinomen ist derzeit aktiv.<br />
Von Dezember 1997 bis Dezember 2003 wurden196 Patienten<br />
bei der GSI mit Kohlenstoffionen behandelt. Die lokale<br />
Kontrollrate lag nach 3 Jahren für Schädelbasischordome<br />
bei 81%, für Chondrosarkome bei 100% und für lokal<br />
fortgeschrittene adenoidzystische Karzinome bei 62%. 15<br />
von 17 Patienten mit spinal (8/9) und sakralen (7/8) Chordomen<br />
oder Chondrosarkome und 11 von 15 Patienten<br />
mit anderen Schädelbasistumoren konnten des weiteren<br />
lokal kontrolliert werden. Sechs von 12 Patienten, die eine<br />
Rebestrahlung erhielten, zeigten bisher keine Zeichen einer<br />
erneuten Tumorprogression. Toxizitäten CTC Grad 4<br />
und 5 konnten bisher nicht beobachtet werden.<br />
Unter dem Aspekt der Toxizität ist die Schwerionentherapie<br />
ein sicherer Therapieansatz bei gleichzeitig hohen<br />
Kontrollraten bei Chordomen und low-grade Chondrosar-<br />
Abteilung E050<br />
Klinische Kooperationseinheit Strahlentherapie<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
kome der Schädelbasis sowie bei lokal fortgeschrittenen<br />
adenoidzystischen Karzinomen.<br />
Eine klinische Phase I/II Studie zur kombinierten Photonen-<br />
und Kohlenstoffionentherapie beim lokal fortgeschrittenen<br />
Prostatakarzinom wird derzeit vorbereitet.<br />
Publikationen (* = externer Koautor)<br />
[1] Haberer T*, Becher W*, Schardt D*, et al. Magnetic scanning<br />
system for heavy ion therapy. Nucl Instr Meth Phys Res<br />
1993; 330: 296-304<br />
[2] Krämer M*, Jäkel O, Haberer T*, et al. Treatment planning<br />
for heavy ion radiotherapie: Physical beam model and dose optimization.<br />
Phys Med Biol 2002; 45: 3299-3317<br />
[3] Krämer M*, Scholz M*. Treatment planning for heavy-ion radiotherapy:<br />
Calculation and optimization of biologically effective<br />
dose. Phys Med Biol 2000; 45:3319-3330<br />
[4] Jäkel O, Hartmann GH*, Karger CP*, et al. Quality assurance<br />
for a treatment planning system in scanned ion beam therapy.<br />
Med Phys 2000; 27: 1588-1600<br />
[5] Scholz M*, Kellerer AM*, Kraft-Weyrather W*, et al. Computation<br />
of cell survival in heavy ion beams for therapy. The model<br />
and its approximation. Radiat Environ Biophys 1997; 36: 59-66<br />
Experimentelle Teilchentherapie in vitro und in<br />
vivo<br />
P. Peschke, A. Abdollahi, P. Huber, J. Debus<br />
In Zusammenarbeit mit: C. Karger, DKFZ E040, R. Sanchez-<br />
Brandelik DKFZ V230, S. Heiland, Universität Heidelberg; M.<br />
Scholz, GSI Darmstadt, B. Stierstorfer, Universität München<br />
Die Bestrahlung von Krebspatienten mit schweren Ionen<br />
ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Therapie<br />
von inoperablen, örtlich begrenzt wachsenden Tumoren.<br />
Die vorteilhaften Eigenschaften des Partikelstrahls in Kombination<br />
mit einem “intensitätsmodulierten Rasterscannverfahren”<br />
und einem biologisch-orientiertem Planungssystem<br />
erlauben eine effiziente und konforme Bestrahlung<br />
des Zielvolumens. Die laufenden klinischen Studien zur<br />
Behandlung von fortgeschrittenen Tumoren der Schädelbasis,<br />
die zur Zeit bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung<br />
(GSI) erfolgen, werden durch ein biologisches<br />
Forschungsprogramm zur Charakterisierung des therapeutischen<br />
Schwerionenstrahls begleitet. Dabei beschäftigt sich<br />
ein Projekt mit der Bestimmung der relativen biologischen<br />
Effektivität (RBW) von Kohlenstoffionen im Vergleich zu<br />
Photonen. Im Mittelpunkt der tierexperimentellen Studien<br />
stehen strahlenbedingte Spätschäden des zentralen<br />
Nervensystems (CNS).<br />
Relative biologische Wirksamkeit (RBW) und<br />
Charakterisierung von Strahlenspätschäden am<br />
Rückenmark der Ratte nach Photonen- und<br />
Schwerionenbestrahlung<br />
In einer ersten Serie von Untersuchungen wurde der<br />
craniale Anteil des cervicalen Rückenmarks von Ratten mit<br />
ein bzw. zwei Fraktionen Kohlenstoffionen oder Photonen<br />
bestrahlt. Das Zielvolumen (Feldgröße: 10 x 15 mm) war<br />
entweder im Eingangsbereich (Plateau-Region) eines 270<br />
MeV/u 12 C-Strahls oder zentral im erweiterten Bragg-Peak<br />
eines 140 MeV/u 12 C-Strahls positioniert. Die Bestrahlungen<br />
mit Photonen wurden an einem Linearbeschleuniger<br />
(Siemens MPX, 15 MeV) mit einer Dosisrate von 5 Gy/Min.<br />
unter Referenzbedingungen durchgeführt. Die<br />
Behandlungsfelder wurden über einen Multileaf-Kollimator<br />
mit einer Blende von 10 x 15 mm definiert. Pro Behandlungsarm<br />
wurden 30 Tiere, unterteilt in 5 Gruppen (n = 6) mit