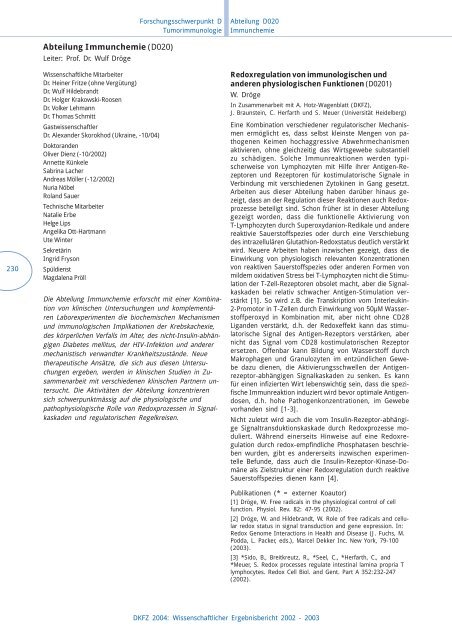MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
230<br />
Abteilung Immunchemie (D020)<br />
Leiter: Prof. Dr. Wulf Dröge<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Dr. Heiner Fritze (ohne Vergütung)<br />
Dr. Wulf Hildebrandt<br />
Dr. Holger Krakowski-Roosen<br />
Dr. Volker Lehmann<br />
Dr. Thomas Schmitt<br />
Gastwissenschaftler<br />
Dr. Alexander Skorokhod (Ukraine, -10/04)<br />
Doktoranden<br />
Oliver Dienz (-10/2002)<br />
Annette Künkele<br />
Sabrina Lacher<br />
Andreas Möller (-12/2002)<br />
Nuria Nöbel<br />
Roland Sauer<br />
Technische Mitarbeiter<br />
Natalie Erbe<br />
Helge Lips<br />
Angelika Ott-Hartmann<br />
Ute Winter<br />
Sekretärin<br />
Ingrid Fryson<br />
Spüldienst<br />
Magdalena Pröll<br />
Forschungsschwerpunkt D<br />
Tumorimmunologie<br />
Die Abteilung Immunchemie erforscht mit einer Kombination<br />
von klinischen Untersuchungen und komplementären<br />
Laborexperimenten die biochemischen Mechanismen<br />
und immunologischen Implikationen der Krebskachexie,<br />
des körperlichen Verfalls im Alter, des nicht-Insulin-abhängigen<br />
Diabetes mellitus, der HIV-Infektion und anderer<br />
mechanistisch verwandter Krankheitszustände. Neue<br />
therapeutische Ansätze, die sich aus diesen Untersuchungen<br />
ergeben, werden in klinischen Studien in Zusammenarbeit<br />
mit verschiedenen klinischen Partnern untersucht.<br />
Die Aktivitäten der Abteilung konzentrieren<br />
sich schwerpunktmässig auf die physiologische und<br />
pathophysiologische Rolle von Redoxprozessen in Signalkaskaden<br />
und regulatorischen Regelkreisen.<br />
Abteilung D020<br />
Immunchemie<br />
Redoxregulation von immunologischen und<br />
anderen physiologischen Funktionen (D0201)<br />
W. Dröge<br />
In Zusammenarbeit mit A. Hotz-Wagenblatt (DKFZ),<br />
J. Braunstein, C. Herfarth und S. Meuer (Universität Heidelberg)<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Eine Kombination verschiedener regulatorischer Mechanismen<br />
ermöglicht es, dass selbst kleinste Mengen von pathogenen<br />
Keimen hochaggressive Abwehrmechanismen<br />
aktivieren, ohne gleichzeitig das Wirtsgewebe substantiell<br />
zu schädigen. Solche Immunreaktionen werden typischerweise<br />
von Lymphozyten mit Hilfe ihrer Antigen-Rezeptoren<br />
und Rezeptoren für kostimulatorische Signale in<br />
Verbindung mit verschiedenen Zytokinen in Gang gesetzt.<br />
Arbeiten aus dieser Abteilung haben darüber hinaus gezeigt,<br />
dass an der Regulation dieser Reaktionen auch Redoxprozesse<br />
beteiligt sind. Schon früher ist in dieser Abteilung<br />
gezeigt worden, dass die funktionelle Aktivierung von<br />
T-Lymphozyten durch Superoxydanion-Redikale und andere<br />
reaktivie Sauerstoffspezies oder durch eine Verschiebung<br />
des intrazellulären Glutathion-Redoxstatus deutlich verstärkt<br />
wird. Neuere Arbeiten haben inzwischen gezeigt, dass die<br />
Einwirkung von physiologisch relevanten Konzentrationen<br />
von reaktiven Sauerstoffspezies oder anderen Formen von<br />
mildem oxidativen Stress bei T-Lymphozyten nicht die Stimulation<br />
der T-Zell-Rezeptoren obsolet macht, aber die Signalkaskaden<br />
bei relativ schwacher Antigen-Stimulation verstärkt<br />
[1]. So wird z.B. die Transkription vom Interleukin-<br />
2-Promotor in T-Zellen durch Einwirkung von 50µM Wasserstoffperoxyd<br />
in Kombination mit, aber nicht ohne CD28<br />
Liganden verstärkt, d.h. der Redoxeffekt kann das stimulatorische<br />
Signal des Antigen-Rezeptors verstärken, aber<br />
nicht das Signal vom CD28 kostimulatorischen Rezeptor<br />
ersetzen. Offenbar kann Bildung von Wasserstoff durch<br />
Makrophagen und Granulozyten im entzündlichen Gewebe<br />
dazu dienen, die Aktivierungsschwellen der Antigenrezeptor-abhängigen<br />
Signalkaskaden zu senken. Es kann<br />
für einen infizierten Wirt lebenswichtig sein, dass die spezifische<br />
Immunreaktion induziert wird bevor optimale Antigendosen,<br />
d.h. hohe Pathogenkonzentrationen, im Gewebe<br />
vorhanden sind [1-3].<br />
Nicht zuletzt wird auch die vom Insulin-Rezeptor-abhängige<br />
Signaltransduktionskaskade durch Redoxprozesse moduliert.<br />
Während einerseits Hinweise auf eine Redoxregulation<br />
durch redox-empfindliche Phosphatasen beschrieben<br />
wurden, gibt es andererseits inzwischen experimentelle<br />
Befunde, dass auch die Insulin-Rezeptor-Kinase-Domäne<br />
als Zielstruktur einer Redoxregulation durch reaktive<br />
Sauerstoffspezies dienen kann [4].<br />
Publikationen (* = externer Koautor)<br />
[1] Dröge, W. Free radicals in the physiological control of cell<br />
function. Physiol. Rev. 82: 47-95 (2002).<br />
[2] Dröge, W. and Hildebrandt, W. Role of free radicals and cellular<br />
redox status in signal transduction and gene expression. In:<br />
Redox Genome Interactions in Health and Disease (J. Fuchs, M.<br />
Podda, L. Packer, eds.), Marcel Dekker Inc. New York, 79-100<br />
(2003).<br />
[3] *Sido, B., Breitkreutz, R., *Seel, C., *Herfarth, C., and<br />
*Meuer, S. Redox processes regulate intestinal lamina propria T<br />
lymphocytes. Redox Cell Biol. and Gent. Part A 352:232-247<br />
(2002).