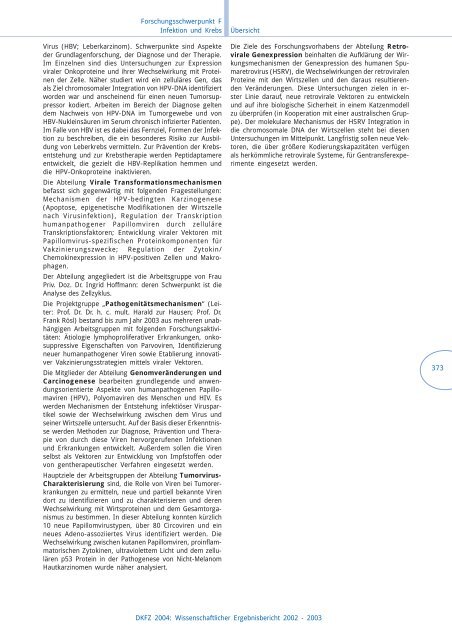MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt F<br />
Infektion und Krebs Übersicht<br />
Virus (HBV; Leberkarzinom). Schwerpunkte sind Aspekte<br />
der Grundlagenforschung, der Diagnose und der Therapie.<br />
Im Einzelnen sind dies Untersuchungen zur Expression<br />
viraler Onkoproteine und ihrer Wechselwirkung mit Proteinen<br />
der Zelle. Näher studiert wird ein zelluläres Gen, das<br />
als Ziel chromosomaler Integration von HPV-DNA identifiziert<br />
worden war und anscheinend für einen neuen Tumorsuppressor<br />
kodiert. Arbeiten im Bereich der Diagnose gelten<br />
dem Nachweis von HPV-DNA im Tumorgewebe und von<br />
HBV-Nukleinsäuren im Serum chronisch infizierter Patienten.<br />
Im Falle von HBV ist es dabei das Fernziel, Formen der Infektion<br />
zu beschreiben, die ein besonderes Risiko zur Ausbildung<br />
von Leberkrebs vermitteln. Zur Prävention der Krebsentstehung<br />
und zur Krebstherapie werden Peptidaptamere<br />
entwickelt, die gezielt die HBV-Replikation hemmen und<br />
die HPV-Onkoproteine inaktivieren.<br />
Die Abteilung Virale Transformationsmechanismen<br />
befasst sich gegenwärtig mit folgenden Fragestellungen:<br />
Mechanismen der HPV-bedingten Karzinogenese<br />
(Apoptose, epigenetische Modifikationen der Wirtszelle<br />
nach Virusinfektion), Regulation der Transkription<br />
humanpathogener Papillomviren durch zelluläre<br />
Transkriptionsfaktoren; Entwicklung viraler Vektoren mit<br />
Papillomvirus-spezifischen Proteinkomponenten für<br />
Vakzinierungszwecke; Regulation der Zytokin/<br />
Chemokinexpression in HPV-positiven Zellen und Makrophagen.<br />
Der Abteilung angegliedert ist die Arbeitsgruppe von Frau<br />
Priv. Doz. Dr. Ingrid Hoffmann: deren Schwerpunkt ist die<br />
Analyse des Zellzyklus.<br />
Die Projektgruppe „Pathogenitätsmechanismen“ (Leiter:<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Harald zur Hausen; Prof. Dr.<br />
Frank Rösl) bestand bis zum Jahr 2003 aus mehreren unabhängigen<br />
Arbeitsgruppen mit folgenden Forschungsaktivitäten:<br />
Ätiologie lymphoproliferativer Erkrankungen, onkosuppressive<br />
Eigenschaften von Parvoviren, Identifizierung<br />
neuer humanpathogener Viren sowie Etablierung innovativer<br />
Vakzinierungsstrategien mittels viraler Vektoren.<br />
Die Mitglieder der Abteilung Genomveränderungen und<br />
Carcinogenese bearbeiten grundlegende und anwendungsorientierte<br />
Aspekte von humanpathogenen Papillomaviren<br />
(HPV), Polyomaviren des Menschen und HIV. Es<br />
werden Mechanismen der Entstehung infektiöser Viruspartikel<br />
sowie der Wechselwirkung zwischen dem Virus und<br />
seiner Wirtszelle untersucht. Auf der Basis dieser Erkenntnisse<br />
werden Methoden zur Diagnose, Prävention und Therapie<br />
von durch diese Viren hervorgerufenen Infektionen<br />
und Erkrankungen entwickelt. Außerdem sollen die Viren<br />
selbst als Vektoren zur Entwicklung von Impfstoffen oder<br />
von gentherapeutischer Verfahren eingesetzt werden.<br />
Hauptziele der Arbeitsgruppen der Abteilung Tumorvirus-<br />
Charakterisierung sind, die Rolle von Viren bei Tumorerkrankungen<br />
zu ermitteln, neue und partiell bekannte Viren<br />
dort zu identifizieren und zu charakterisieren und deren<br />
Wechselwirkung mit Wirtsproteinen und dem Gesamtorganismus<br />
zu bestimmen. In dieser Abteilung konnten kürzlich<br />
10 neue Papillomvirustypen, über 80 Circoviren und ein<br />
neues Adeno-assoziiertes Virus identifiziert werden. Die<br />
Wechselwirkung zwischen kutanen Papillomviren, proinflammatorischen<br />
Zytokinen, ultraviolettem Licht und dem zellulären<br />
p53 Protein in der Pathogenese von Nicht-Melanom<br />
Hautkarzinomen wurde näher analysiert.<br />
Die Ziele des Forschungsvorhabens der Abteilung Retrovirale<br />
Genexpression beinhalten die Aufklärung der Wirkungsmechanismen<br />
der Genexpression des humanen Spumaretrovirus<br />
(HSRV), die Wechselwirkungen der retroviralen<br />
Proteine mit den Wirtszellen und den daraus resultierenden<br />
Veränderungen. Diese Untersuchungen zielen in erster<br />
Linie darauf, neue retrovirale Vektoren zu entwickeln<br />
und auf ihre biologische Sicherheit in einem Katzenmodell<br />
zu überprüfen (in Kooperation mit einer australischen Gruppe).<br />
Der molekulare Mechanismus der HSRV Integration in<br />
die chromosomale DNA der Wirtszellen steht bei diesen<br />
Untersuchungen im Mittelpunkt. Langfristig sollen neue Vektoren,<br />
die über größere Kodierungskapazitäten verfügen<br />
als herkömmliche retrovirale Systeme, für Gentransferexperimente<br />
eingesetzt werden.<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
373