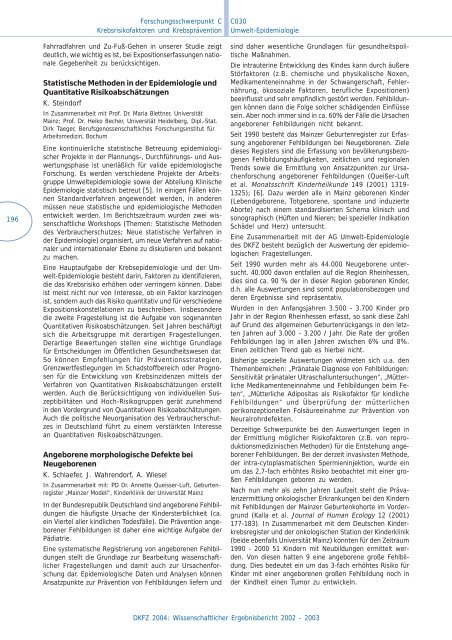MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
196<br />
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention<br />
Fahrradfahren und Zu-Fuß-Gehen in unserer Studie zeigt<br />
deutlich, wie wichtig es ist, bei Expositionserfassungen nationale<br />
Gegebenheit zu berücksichtigen.<br />
Statistische Methoden in der Epidemiologie und<br />
Quantitative Risikoabschätzungen<br />
K. Steindorf<br />
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Maria Blettner, Universität<br />
Mainz; Prof. Dr. Heiko Becher, Universität Heidelberg, Dipl.-Stat.<br />
Dirk Taeger, Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für<br />
Arbeitsmedizin, Bochum<br />
Eine kontinuierliche statistische Betreuung epidemiologischer<br />
Projekte in der Plannungs-, Durchführungs- und Auswertungsphase<br />
ist unerläßlich für valide epidemiologische<br />
Forschung. Es werden verschiedene Projekte der Arbeitsgruppe<br />
Umweltepidemiologie sowie der Abteilung Klinische<br />
Epidemiologie statistisch betreut [5]. In einigen Fällen können<br />
Standardverfahren angewendet werden, in anderen<br />
müssen neue statistische und epidemiologische Methoden<br />
entwickelt werden. Im Berichtszeitraum wurden zwei wissenschaftliche<br />
Workshops (Themen: Statistische Methoden<br />
des Verbraucherschutzes; Neue statistische Verfahren in<br />
der Epidemiologie) organisiert, um neue Verfahren auf nationaler<br />
und internationaler Ebene zu diskutieren und bekannt<br />
zu machen.<br />
Eine Hauptaufgabe der Krebsepidemiologie und der Umwelt-Epidemiologie<br />
besteht darin, Faktoren zu identifizieren,<br />
die das Krebsrisiko erhöhen oder verringern können. Dabei<br />
ist meist nicht nur von Interesse, ob ein Faktor karzinogen<br />
ist, sondern auch das Risiko quantitativ und für verschiedene<br />
Expositionskonstellationen zu beschreiben. Insbesondere<br />
die zweite Fragestellung ist die Aufgabe von sogenannten<br />
Quantitativen Risikoabschätzungen. Seit Jahren beschäftigt<br />
sich die Arbeitsgruppe mit derartigen Fragestellungen.<br />
Derartige Bewertungen stellen eine wichtige Grundlage<br />
für Entscheidungen im Öffentlichen Gesundheitswesen dar.<br />
So können Empfehlungen für Präventionsstrategien,<br />
Grenzwertfestlegungen im Schadstoffbereich oder Prognosen<br />
für die Entwicklung von Krebsinzidenzen mittels der<br />
Verfahren von Quantitativen Risikoabschätzungen erstellt<br />
werden. Auch die Berücksichtigung von individuellen Suszeptibilitäten<br />
und Hoch-Risikogruppen gerät zunehmend<br />
in den Vordergrund von Quantitativen Risikoabschätzungen.<br />
Auch die politische Neuorganisation des Verbraucherschutzes<br />
in Deutschland führt zu einem verstärkten Interesse<br />
an Quantitativen Risikoabschätzungen.<br />
Angeborene morphologische Defekte bei<br />
Neugeborenen<br />
K. Schlaefer, J. Wahrendorf, A. Wiesel<br />
In Zusammenarbeit mit: PD Dr. Annette Queisser-Luft, Geburtenregister<br />
„Mainzer Modell“, Kinderklinik der Universität Mainz<br />
In der Bundesrepublik Deutschland sind angeborene Fehlbildungen<br />
die häufigste Ursache der Kindersterblichkeit (ca.<br />
ein Viertel aller kindlichen Todesfälle). Die Prävention angeborener<br />
Fehlbildungen ist daher eine wichtige Aufgabe der<br />
Pädiatrie.<br />
Eine systematische Registrierung von angeborenen Fehlbildungen<br />
stellt die Grundlage zur Bearbeitung wissenschaftlicher<br />
Fragestellungen und damit auch zur Ursachenforschung<br />
dar. Epidemiologische Daten und Analysen können<br />
Ansatzpunkte zur Prävention von Fehlbildungen liefern und<br />
C030<br />
Umwelt-Epidemiologie<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
sind daher wesentliche Grundlagen für gesundheitspolitische<br />
Maßnahmen.<br />
Die intrauterine Entwicklung des Kindes kann durch äußere<br />
Störfaktoren (z.B. chemische und physikalische Noxen,<br />
Medikamenteneinnahme in der Schwangerschaft, Fehlernährung,<br />
ökosoziale Faktoren, berufliche Expositionen)<br />
beeinflusst und sehr empfindlich gestört werden. Fehlbildungen<br />
können dann die Folge solcher schädigenden Einflüsse<br />
sein. Aber noch immer sind in ca. 60% der Fälle die Ursachen<br />
angeborener Fehlbildungen nicht bekannt.<br />
Seit 1990 besteht das Mainzer Geburtenregister zur Erfassung<br />
angeborener Fehlbildungen bei Neugeborenen. Ziele<br />
dieses Registers sind die Erfassung von bevölkerungsbezogenen<br />
Fehlbildungshäufigkeiten, zeitlichen und regionalen<br />
Trends sowie die Ermittlung von Ansatzpunkten zur Ursachenforschung<br />
angeborener Fehlbildungen (Queißer-Luft<br />
et al. Monatsschrift Kinderheilkunde 149 (2001) 1319-<br />
1325); [6]. Dazu werden alle in Mainz geborenen Kinder<br />
(Lebendgeborene, Totgeborene, spontane und induzierte<br />
Aborte) nach einem standardisierten Schema klinisch und<br />
sonographisch (Hüften und Nieren; bei spezieller Indikation<br />
Schädel und Herz) untersucht.<br />
Eine Zusammenarbeit mit der AG Umwelt-Epidemiologie<br />
des DKFZ besteht bezüglich der Auswertung der epidemiologischen<br />
Fragestellungen.<br />
Seit 1990 wurden mehr als 44.000 Neugeborene untersucht.<br />
40.000 davon entfallen auf die Region Rheinhessen,<br />
dies sind ca. 90 % der in dieser Region geborenen Kinder,<br />
d.h. alle Auswertungen sind somit populationsbezogen und<br />
deren Ergebnisse sind repräsentativ.<br />
Wurden in den Anfangsjahren 3.500 - 3.700 Kinder pro<br />
Jahr in der Region Rheinhessen erfasst, so sank diese Zahl<br />
auf Grund des allgemeinen Geburtenrückgangs in den letzten<br />
Jahren auf 3.000 - 3.200 / Jahr. Die Rate der großen<br />
Fehlbildungen lag in allen Jahren zwischen 6% und 8%.<br />
Einen zeitlichen Trend gab es hierbei nicht.<br />
Bisherige spezielle Auswertungen widmeten sich u.a. den<br />
Themenbereichen: „Pränatale Diagnose von Fehlbildungen:<br />
Sensitivität pränataler Ultraschalluntersuchungen“, „Mütterliche<br />
Medikamenteneinnahme und Fehlbildungen beim Feten“,<br />
„Mütterliche Adipositas als Risikofaktor für kindliche<br />
Fehlbildungen“ und Überprüfung der mütterlichen<br />
perikonzeptionellen Folsäureeinahme zur Prävention von<br />
Neuralrohrdefekten.<br />
Derzeitige Schwerpunkte bei den Auswertungen liegen in<br />
der Ermittlung möglicher Risikofaktoren (z.B. von reproduktionsmedizinischen<br />
Methoden) für die Entstehung angeborener<br />
Fehlbildungen. Bei der derzeit invasivsten Methode,<br />
der intra-cytoplasmatischen Spermieninjektion, wurde ein<br />
um das 2,7-fach erhöhtes Risiko beobachtet mit einer großen<br />
Fehlbildungen geboren zu werden.<br />
Nach nun mehr als zehn Jahren Laufzeit steht die Prävalenzermittlung<br />
onkologischer Erkrankungen bei den Kindern<br />
mit Fehlbildungen der Mainzer Geburtenkohorte im Vordergrund<br />
(Kalla et al. Journal of Human Ecology 12 (2001)<br />
177-183). In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderkrebsregister<br />
und der onkologischen Station der Kinderklinik<br />
(beide ebenfalls Universität Mainz) konnten für den Zeitraum<br />
1990 - 2000 51 Kindern mit Neubildungen ermittelt werden.<br />
Von diesen hatten 9 eine angeborene große Fehlbildung.<br />
Dies bedeutet ein um das 3-fach erhöhtes Risiko für<br />
Kinder mit einer angeborenen großen Fehlbildung noch in<br />
der Kindheit einen Tumor zu entwickeln.