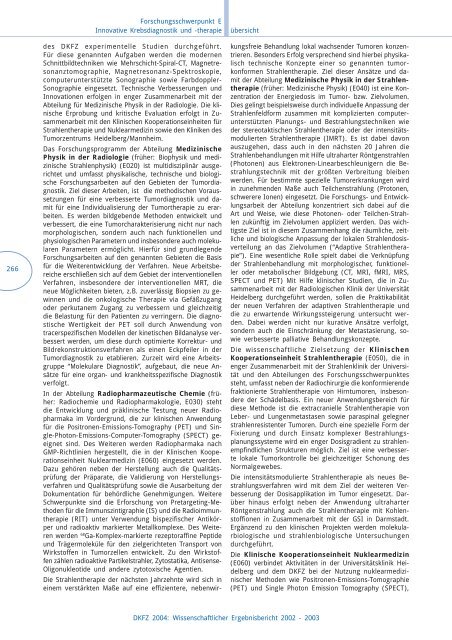MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
266<br />
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie übersicht<br />
des DKFZ experimentelle Studien durchgeführt.<br />
Für diese genannten Aufgaben werden die modernen<br />
Schnittbildtechniken wie Mehrschicht-Spiral-CT, Magnetresonanztomographie,<br />
Magnetresonanz-Spektroskopie,<br />
computerunterstützte Sonographie sowie Farbdoppler-<br />
Sonographie eingesetzt. Technische Verbesserungen und<br />
Innovationen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der<br />
Abteilung für Medizinische Physik in der Radiologie. Die klinische<br />
Erprobung und kritische Evaluation erfolgt in Zusammenarbeit<br />
mit den Klinischen Kooperationseinheiten für<br />
Strahlentherapie und Nuklearmedizin sowie den Kliniken des<br />
Tumorzentrums Heidelberg/Mannheim.<br />
Das Forschungsprogramm der Abteilung Medizinische<br />
Physik in der Radiologie (früher: Biophysik und medizinische<br />
Strahlenphysik) (E020) ist multidisziplinär ausgerichtet<br />
und umfasst physikalische, technische und biologische<br />
Forschungsarbeiten auf den Gebieten der Tumordiagnostik.<br />
Ziel dieser Arbeiten, ist die methodischen Voraussetzungen<br />
für eine verbesserte Tumordiagnostik und damit<br />
für eine Individualisierung der Tumortherapie zu erarbeiten.<br />
Es werden bildgebende Methoden entwickelt und<br />
verbessert, die eine Tumorcharakterisierung nicht nur nach<br />
morphologischen, sondern auch nach funktionellen und<br />
physiologischen Parametern und insbesondere auch molekularen<br />
Parametern ermöglicht. Hierfür sind grundlegende<br />
Forschungsarbeiten auf den genannten Gebieten die Basis<br />
für die Weiterentwicklung der Verfahren. Neue Arbeitsbereiche<br />
erschließen sich auf dem Gebiet der interventionellen<br />
Verfahren, insbesondere der interventionellen MRT, die<br />
neue Möglichkeiten bieten, z.B. zuverlässig Biopsien zu gewinnen<br />
und die onkologische Therapie via Gefäßzugang<br />
oder perkutanem Zugang zu verbessern und gleichzeitig<br />
die Belastung für den Patienten zu verringern. Die diagnostische<br />
Wertigkeit der PET soll durch Anwendung von<br />
tracerspezifischen Modellen der kinetischen Bildanalyse verbessert<br />
werden, um diese durch optimierte Korrektur- und<br />
Bildrekonstruktionsverfahren als einen Eckpfeiler in der<br />
Tumordiagnostik zu etablieren. Zurzeit wird eine Arbeitsgruppe<br />
“Molekulare Diagnostik”, aufgebaut, die neue Ansätze<br />
für eine organ- und krankheitsspezifische Diagnostik<br />
verfolgt.<br />
In der Abteilung Radiopharmazeutische Chemie (früher:<br />
Radiochemie und Radiopharmakologie, E030) steht<br />
die Entwicklung und präklinische Testung neuer Radiopharmaka<br />
im Vordergrund, die zur klinischen Anwendung<br />
für die Positronen-Emissions-Tomography (PET) und Single-Photon-Emissions-Computer-Tomography<br />
(SPECT) geeignet<br />
sind. Des Weiteren werden Radiopharmaka nach<br />
GMP-Richtlinien hergestellt, die in der Klinischen Kooperationseinheit<br />
Nuklearmedizin (E060) eingesetzt werden.<br />
Dazu gehören neben der Herstellung auch die Qualitätsprüfung<br />
der Präparate, die Validierung von Herstellungsverfahren<br />
und Qualitätsprüfung sowie die Ausarbeitung der<br />
Dokumentation für behördliche Genehmigungen. Weitere<br />
Schwerpunkte sind die Erforschung von Pretargeting-Methoden<br />
für die Immunszintigraphie (IS) und die Radioimmuntherapie<br />
(RIT) unter Verwendung bispezifischer Antikörper<br />
und radioaktiv markierter Metallkomplexe. Des Weiteren<br />
werden 68Ga-Komplex-markierte rezeptoraffine Peptide<br />
und Trägermoleküle für den zielgerichteten Transport von<br />
Wirkstoffen in Tumorzellen entwickelt. Zu den Wirkstoffen<br />
zählen radioaktive Partikelstrahler, Zytostatika, Antisense-<br />
Oligonukleotide und andere zytotoxische Agentien.<br />
Die Strahlentherapie der nächsten Jahrzehnte wird sich in<br />
einem verstärkten Maße auf eine effizientere, nebenwir-<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
kungsfreie Behandlung lokal wachsender Tumoren konzentrieren.<br />
Besonders Erfolg versprechend sind hierbei physikalisch<br />
technische Konzepte einer so genannten tumorkonformen<br />
Strahlentherapie. Ziel dieser Ansätze und damit<br />
der Abteilung Medizinische Physik in der Strahlentherapie<br />
(früher: Medizinische Physik) (E040) ist eine Konzentration<br />
der Energiedosis im Tumor- bzw. Zielvolumen.<br />
Dies gelingt beispielsweise durch individuelle Anpassung der<br />
Strahlenfeldform zusammen mit komplizierten computerunterstützten<br />
Planungs- und Bestrahlungstechniken wie<br />
der stereotaktischen Strahlentherapie oder der intensitätsmodulierten<br />
Strahlentherapie (IMRT). Es ist dabei davon<br />
auszugehen, dass auch in den nächsten 20 Jahren die<br />
Strahlenbehandlungen mit Hilfe ultraharter Röntgenstrahlen<br />
(Photonen) aus Elektronen-Linearbeschleunigern die Bestrahlungstechnik<br />
mit der größten Verbreitung bleiben<br />
werden. Für bestimmte spezielle Tumorerkrankungen wird<br />
in zunehmenden Maße auch Teilchenstrahlung (Protonen,<br />
schwerere Ionen) eingesetzt. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit<br />
der Abteilung konzentriert sich dabei auf die<br />
Art und Weise, wie diese Photonen- oder Teilchen-Strahlen<br />
zukünftig im Zielvolumen appliziert werden. Das wichtigste<br />
Ziel ist in diesem Zusammenhang die räumliche, zeitliche<br />
und biologische Anpassung der lokalen Strahlendosisverteilung<br />
an das Zielvolumen (“Adaptive Strahlentherapie”).<br />
Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Verknüpfung<br />
der Strahlenbehandlung mit morphologischer, funktioneller<br />
oder metabolischer Bildgebung (CT, MRI, fMRI, MRS,<br />
SPECT und PET) Mit Hilfe klinischer Studien, die in Zusammenarbeit<br />
mit der Radiologischen Klinik der Universität<br />
Heidelberg durchgeführt werden, sollen die Praktikabilität<br />
der neuen Verfahren der adaptiven Strahlentherapie und<br />
die zu erwartende Wirkungssteigerung untersucht werden.<br />
Dabei werden nicht nur kurative Ansätze verfolgt,<br />
sondern auch die Einschränkung der Metastasierung, sowie<br />
verbesserte palliative Behandlungskonzepte.<br />
Die wissenschaftliche Zielsetzung der Klinischen<br />
Kooperationseinheit Strahlentherapie (E050), die in<br />
enger Zusammenarbeit mit der Strahlenklinik der Universität<br />
und den Abteilungen des Forschungsschwerpunktes<br />
steht, umfasst neben der Radiochirurgie die konformierende<br />
fraktionierte Strahlentherapie von Hirntumoren, insbesondere<br />
der Schädelbasis. Ein neuer Anwendungsbereich für<br />
diese Methode ist die extracranielle Strahlentherapie von<br />
Leber- und Lungenmetastasen sowie paraspinal gelegner<br />
strahlenresistenter Tumoren. Durch eine spezielle Form der<br />
Fixierung und durch Einsatz komplexer Bestrahlungsplanungssysteme<br />
wird ein enger Dosisgradient zu strahlenempfindlichen<br />
Strukturen möglich. Ziel ist eine verbesserte<br />
lokale Tumorkontrolle bei gleichzeitiger Schonung des<br />
Normalgewebes.<br />
Die intensitätsmodulierte Strahlentherapie als neues Bestrahlungsverfahren<br />
wird mit dem Ziel der weiteren Verbesserung<br />
der Dosisapplikation im Tumor eingesetzt. Darüber<br />
hinaus erfolgt neben der Anwendung ultraharter<br />
Röntgenstrahlung auch die Strahlentherapie mit Kohlenstoffionen<br />
in Zusammenarbeit mit der GSI in Darmstadt.<br />
Ergänzend zu den klinischen Projekten werden molekularbiologische<br />
und strahlenbiologische Untersuchungen<br />
durchgeführt.<br />
Die Klinische Kooperationseinheit Nuklearmedizin<br />
(E060) verbindet Aktivitäten in der Universitätsklinik Heidelberg<br />
und dem DKFZ bei der Nutzung nuklearmedizinischer<br />
Methoden wie Positronen-Emissions-Tomographie<br />
(PET) und Single Photon Emission Tomography (SPECT),