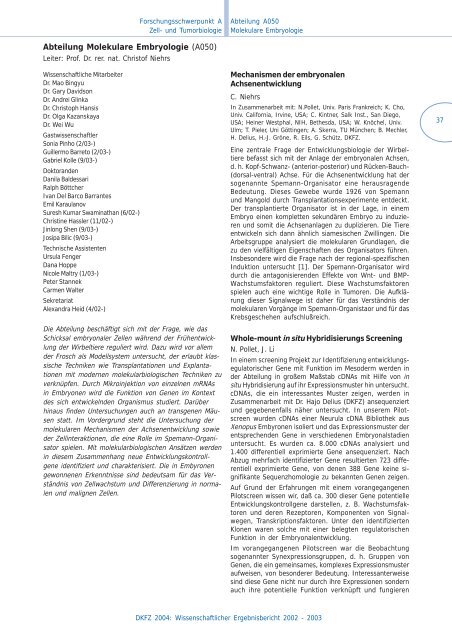MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt A<br />
Zell- und Tumorbiologie<br />
Abteilung Molekulare Embryologie (A050)<br />
Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Christof Niehrs<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Dr. Mao Bingyu<br />
Dr. Gary Davidson<br />
Dr. Andrei Glinka<br />
Dr. Christoph Hansis<br />
Dr. Olga Kazanskaya<br />
Dr. Wei Wu<br />
Gastwissenschaftler<br />
Sonia Pinho (2/03-)<br />
Guillermo Barreto (2/03-)<br />
Gabriel Kolle (9/03-)<br />
Doktoranden<br />
Danila Baldessari<br />
Ralph Böttcher<br />
Ivan Del Barco Barrantes<br />
Emil Karaulanov<br />
Suresh Kumar Swaminathan (6/02-)<br />
Christine Hassler (11/02-)<br />
Jinlong Shen (9/03-)<br />
Josipa Bilic (9/03-)<br />
Technische Assistenten<br />
Ursula Fenger<br />
Dana Hoppe<br />
Nicole Maltry (1/03-)<br />
Peter Stannek<br />
Carmen Walter<br />
Sekretariat<br />
Alexandra Heid (4/02-)<br />
Die Abteilung beschäftigt sich mit der Frage, wie das<br />
Schicksal embryonaler Zellen während der Frühentwicklung<br />
der Wirbeltiere reguliert wird. Dazu wird vor allem<br />
der Frosch als Modellsystem untersucht, der erlaubt klassische<br />
Techniken wie Transplantationen und Explantationen<br />
mit modernen molekularbiologischen Techniken zu<br />
verknüpfen. Durch Mikroinjektion von einzelnen mRNAs<br />
in Embryonen wird die Funktion von Genen im Kontext<br />
des sich entwickelnden Organismus studiert. Darüber<br />
hinaus finden Untersuchungen auch an transgenen Mäusen<br />
statt. Im Vordergrund steht die Untersuchung der<br />
molekularen Mechanismen der Achsenentwicklung sowie<br />
der Zellinteraktionen, die eine Rolle im Spemann-Organisator<br />
spielen. Mit molekularbiologischen Ansätzen werden<br />
in diesem Zusammenhang neue Entwicklungskontrollgene<br />
identifiziert und charakterisiert. Die in Embyronen<br />
gewonnenen Erkenntnisse sind bedeutsam für das Verständnis<br />
von Zellwachstum und Differenzierung in normalen<br />
und malignen Zellen.<br />
Abteilung A050<br />
Molekulare Embryologie<br />
Mechanismen der embryonalen<br />
Achsenentwicklung<br />
C. Niehrs<br />
In Zusammenarbeit mit: N.Pollet, Univ. Paris Frankreich; K. Cho,<br />
Univ. California, Irvine, USA; C. Kintner, Salk Inst., San Diego,<br />
USA; Heiner Westphal, NIH, Bethesda, USA; W. Knöchel, Univ.<br />
Ulm; T. Pieler, Uni Göttingen; A. Skerra, TU München; B. Mechler,<br />
H. Delius, H.-J. Gröne, R. Eils, G. Schütz, DKFZ.<br />
Eine zentrale Frage der Entwicklungsbiologie der Wirbeltiere<br />
befasst sich mit der Anlage der embryonalen Achsen,<br />
d. h. Kopf-Schwanz- (anterior-posterior) und Rücken-Bauch-<br />
(dorsal-ventral) Achse. Für die Achsenentwicklung hat der<br />
sogenannte Spemann-Organisator eine herausragende<br />
Bedeutung. Dieses Gewebe wurde 1926 von Spemann<br />
und Mangold durch Transplantationsexperimente entdeckt.<br />
Der transplantierte Organisator ist in der Lage, in einem<br />
Embryo einen kompletten sekundären Embryo zu induzieren<br />
und somit die Achsenanlagen zu duplizieren. Die Tiere<br />
entwickeln sich dann ähnlich siamesischen Zwillingen. Die<br />
Arbeitsgruppe analysiert die molekularen Grundlagen, die<br />
zu den vielfältigen Eigenschaften des Organisators führen.<br />
Insbesondere wird die Frage nach der regional-spezifischen<br />
Induktion untersucht [1]. Der Spemann-Organisator wird<br />
durch die antagonisierenden Effekte von Wnt- und BMP-<br />
Wachstumsfaktoren reguliert. Diese Wachstumsfaktoren<br />
spielen auch eine wichtige Rolle in Tumoren. Die Aufklärung<br />
dieser Signalwege ist daher für das Verständnis der<br />
molekularen Vorgänge im Spemann-Organistaor und für das<br />
Krebsgeschehen aufschlußreich.<br />
Whole-mount in situ Hybridisierungs Screening<br />
N. Pollet, J. Li<br />
In einem screening Projekt zur Identifizierung entwicklungsegulatorischer<br />
Gene mit Funktion im Mesoderm werden in<br />
der Abteilung in großem Maßstab cDNAs mit Hilfe von in<br />
situ Hybridisierung auf ihr Expressionsmuster hin untersucht.<br />
cDNAs, die ein interessantes Muster zeigen, werden in<br />
Zusammenarbeit mit Dr. Hajo Delius (DKFZ) ansequenziert<br />
und gegebenenfalls näher untersucht. In unserem Pilotscreen<br />
wurden cDNAs einer Neurula cDNA Bibliothek aus<br />
Xenopus Embyronen isoliert und das Expressionsmuster der<br />
entsprechenden Gene in verschiedenen Embryonalstadien<br />
untersucht. Es wurden ca. 8.000 cDNAs analysiert und<br />
1.400 differentiell exprimierte Gene ansequenziert. Nach<br />
Abzug mehrfach identifizierter Gene resultierten 723 differentiell<br />
exprimierte Gene, von denen 388 Gene keine signifikante<br />
Sequenzhomologie zu bekannten Genen zeigen.<br />
Auf Grund der Erfahrungen mit einem vorangegangenen<br />
Pilotscreen wissen wir, daß ca. 300 dieser Gene potentielle<br />
Entwicklungskontrollgene darstellen, z. B. Wachstumsfaktoren<br />
und deren Rezeptoren, Komponenten von Signalwegen,<br />
Transkriptionsfaktoren. Unter den identifizierten<br />
Klonen waren solche mit einer belegten regulatorischen<br />
Funktion in der Embryonalentwicklung.<br />
Im vorangegangenen Pilotscreen war die Beobachtung<br />
sogenannter Synexpressionsgruppen, d. h. Gruppen von<br />
Genen, die ein gemeinsames, komplexes Expressionsmuster<br />
aufweisen, von besonderer Bedeutung. Interessanterweise<br />
sind diese Gene nicht nur durch ihre Expressionen sondern<br />
auch ihre potentielle Funktion verknüpft und fungieren<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
37