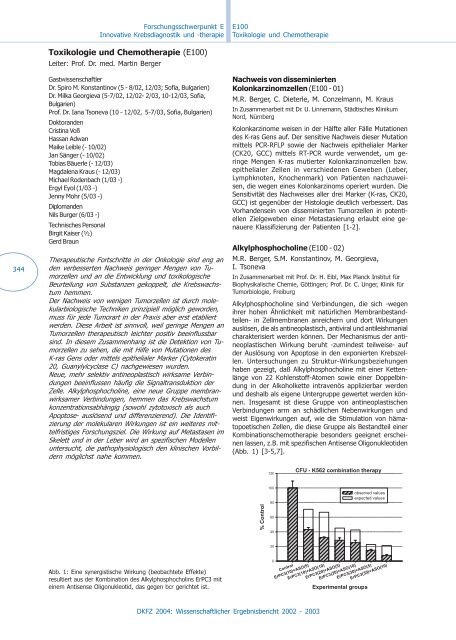MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
344<br />
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
Toxikologie und Chemotherapie (E100)<br />
Leiter: Prof. Dr. med. Martin Berger<br />
Gastwissenschaftler<br />
Dr. Spiro M. Konstantinov (5 - 8/02, 12/03; Sofia, Bulgarien)<br />
Dr. Milka Georgieva (5-7/02, 12/02- 2/03, 10-12/03, Sofia,<br />
Bulgarien)<br />
Prof. Dr. Iana Tsoneva (10 - 12/02, 5-7/03, Sofia, Bulgarien)<br />
Doktoranden<br />
Cristina Voß<br />
Hassan Adwan<br />
Maike Leible (- 10/02)<br />
Jan Sänger (- 10/02)<br />
Tobias Bäuerle (- 12/03)<br />
Magdalena Kraus (- 12/03)<br />
Michael Rodenbach (1/03 -)<br />
Ergyl Eyol (1/03 -)<br />
Jenny Mohr (5/03 -)<br />
Diplomanden<br />
Nils Burger (6/03 -)<br />
Technisches Personal<br />
Birgit Kaiser (½)<br />
Gerd Braun<br />
Therapeutische Fortschritte in der Onkologie sind eng an<br />
den verbesserten Nachweis geringer Mengen von Tumorzellen<br />
und an die Entwicklung und toxikologische<br />
Beurteilung von Substanzen gekoppelt, die Krebswachstum<br />
hemmen.<br />
Der Nachweis von wenigen Tumorzellen ist durch molekularbiologische<br />
Techniken prinzipiell möglich geworden,<br />
muss für jede Tumorart in der Praxis aber erst etabliert<br />
werden. Diese Arbeit ist sinnvoll, weil geringe Mengen an<br />
Tumorzellen therapeutisch leichter positiv beeinflussbar<br />
sind. In diesem Zusammenhang ist die Detektion von Tumorzellen<br />
zu sehen, die mit Hilfe von Mutationen des<br />
K-ras Gens oder mittels epithelialer Marker (Cytokeratin<br />
20, Guanylylcyclase C) nachgewiesen wurden.<br />
Neue, mehr selektiv antineoplastisch wirksame Verbindungen<br />
beeinflussen häufig die Signaltransduktion der<br />
Zelle. Alkylphosphocholine, eine neue Gruppe membranwirksamer<br />
Verbindungen, hemmen das Krebswachstum<br />
konzentrationsabhängig (sowohl zytotoxisch als auch<br />
Apoptose- auslösend und differenzierend). Die Identifizierung<br />
der molekularen Wirkungen ist ein weiteres mittelfristiges<br />
Forschungsziel. Die Wirkung auf Metastasen im<br />
Skelett und in der Leber wird an spezifischen Modellen<br />
untersucht, die pathophysiologisch den klinischen Vorbildern<br />
möglichst nahe kommen.<br />
Abb. 1: Eine synergistische Wirkung (beobachtete Effekte)<br />
resultiert aus der Kombination des Alkylphosphocholins ErPC3 mit<br />
einem Antisense Oligonukleotid, das gegen bcr gerichtet ist.<br />
E100<br />
Toxikologie und Chemotherapie<br />
Nachweis von disseminierten<br />
Kolonkarzinomzellen (E100 - 01)<br />
M.R. Berger, C. Dieterle, M. Conzelmann, M. Kraus<br />
In Zusammenarbeit mit Dr. U. Linnemann, Städtisches Klinikum<br />
Nord, Nürnberg<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Kolonkarzinome weisen in der Hälfte aller Fälle Mutationen<br />
des K-ras Gens auf. Der sensitive Nachweis dieser Mutation<br />
mittels PCR-RFLP sowie der Nachweis epithelialer Marker<br />
(CK20, GCC) mittels RT-PCR wurde verwendet, um geringe<br />
Mengen K-ras mutierter Kolonkarzinomzellen bzw.<br />
epithelialer Zellen in verschiedenen Geweben (Leber,<br />
Lymphknoten, Knochenmark) von Patienten nachzuweisen,<br />
die wegen eines Kolonkarzinoms operiert wurden. Die<br />
Sensitivität des Nachweises aller drei Marker (K-ras, CK20,<br />
GCC) ist gegenüber der Histologie deutlich verbessert. Das<br />
Vorhandensein von disseminierten Tumorzellen in potentiellen<br />
Zielgeweben einer Metastasierung erlaubt eine genauere<br />
Klassifizierung der Patienten [1-2].<br />
Alkylphosphocholine (E100 - 02)<br />
M.R. Berger, S.M. Konstantinov, M. Georgieva,<br />
I. Tsoneva<br />
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. H. Eibl, Max Planck Institut für<br />
Biophysikalische Chemie, Göttingen; Prof. Dr. C. Unger, Klinik für<br />
Tumorbiologie, Freiburg<br />
Alkylphosphocholine sind Verbindungen, die sich -wegen<br />
ihrer hohen Ähnlichkeit mit natürlichen Membranbestandteilen-<br />
in Zellmembranen anreichern und dort Wirkungen<br />
auslösen, die als antineoplastisch, antiviral und antileishmanial<br />
charakterisiert werden können. Der Mechanismus der antineoplastischen<br />
Wirkung beruht -zumindest teilweise- auf<br />
der Auslösung von Apoptose in den exponierten Krebszellen.<br />
Untersuchungen zu Struktur-Wirkungsbeziehungen<br />
haben gezeigt, daß Alkylphosphocholine mit einer Kettenlänge<br />
von 22 Kohlenstoff-Atomen sowie einer Doppelbindung<br />
in der Alkoholkette intravenös applizierbar werden<br />
und deshalb als eigene Untergruppe gewertet werden können.<br />
Insgesamt ist diese Gruppe von antineoplastischen<br />
Verbindungen arm an schädlichen Nebenwirkungen und<br />
weist Eigenwirkungen auf, wie die Stimulation von hämatopoetischen<br />
Zellen, die diese Gruppe als Bestandteil einer<br />
Kombinationschemotherapie besonders geeignet erscheinen<br />
lassen, z.B. mit spezifischen Antisense Oligonukleotiden<br />
(Abb. 1) [3-5,7].<br />
% Control<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
CFU - K562 combination therapy<br />
Control<br />
ErPC3(10)+ASO(5)<br />
ErPC3(10)+ASO(10)<br />
ErPC3(20)+ASO(5)<br />
ErPC3(20)+ASO(10)<br />
ErPC3(30)+ASO(5)<br />
ErPC3(30)+ASO(10)<br />
Experimental groups<br />
observed values<br />
expected values