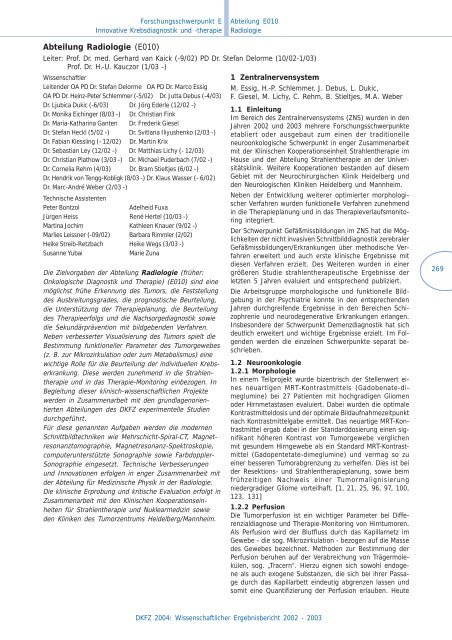MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
Abteilung Radiologie (E010)<br />
Abteilung E010<br />
Radiologie<br />
Leiter: Prof. Dr. med. Gerhard van Kaick (-9/02) PD Dr. Stefan Delorme (10/02-1/03)<br />
Prof. Dr. H.-U. Kauczor (1/03 -)<br />
Wissenschaftler<br />
Leitender OA PD Dr. Stefan Delorme OA PD Dr. Marco Essig<br />
OA PD Dr. Heinz-Peter Schlemmer (-5/02) Dr. Jutta Debus (-4/03)<br />
Dr. Ljubica Dukic (-6/03) Dr. Jörg Ederle (12/02 -)<br />
Dr. Monika Eichinger (8/03 -) Dr. Christian Fink<br />
Dr. Maria-Katharina Ganten Dr. Frederik Giesel<br />
Dr. Stefan Heckl (5/02 -) Dr. Svitlana Iliyushenko (2/03 -)<br />
Dr. Fabian Kiessling (- 12/02) Dr. Martin Krix<br />
Dr. Sebastian Ley (12/02 -) Dr. Matthias Lichy (- 12/03)<br />
Dr. Christian Plathow (3/03 -) Dr. Michael Puderbach (7/02 -)<br />
Dr. Cornelia Rehm (4/03) Dr. Bram Stieltjes (6/02 -)<br />
Dr. Hendrik von Tengg-Kobligk (8/03 -) Dr. Klaus Wasser (- 6/02)<br />
Dr. Marc-André Weber (2/03 -)<br />
Technische Assistenten<br />
Peter Bontzol Adelheid Fuxa<br />
Jürgen Heiss René Hertel (10/03 -)<br />
Martina Jochim Kathleen Knauer (9/02 -)<br />
Marlies Leissner (-09/02) Barbara Rimmler (2/02)<br />
Heike Streib-Retzbach Heike Wegs (3/03 -)<br />
Susanne Yubai Marie Zuna<br />
Die Zielvorgaben der Abteilung Radiologie (früher:<br />
Onkologische Diagnostik und Therapie) (E010) sind eine<br />
möglichst frühe Erkennung des Tumors, die Feststellung<br />
des Ausbreitungsgrades, die prognostische Beurteilung,<br />
die Unterstützung der Therapieplanung, die Beurteilung<br />
des Therapieerfolgs und die Nachsorgediagnostik sowie<br />
die Sekundärprävention mit bildgebenden Verfahren.<br />
Neben verbesserter Visualisierung des Tumors spielt die<br />
Bestimmung funktioneller Parameter des Tumorgewebes<br />
(z. B. zur Mikrozirkulation oder zum Metabolismus) eine<br />
wichtige Rolle für die Beurteilung der individuellen Krebserkrankung.<br />
Diese werden zunehmend in die Strahlentherapie<br />
und in das Therapie-Monitoring einbezogen. In<br />
Begleitung dieser klinisch-wissenschaftlichen Projekte<br />
werden in Zusammenarbeit mit den grundlagenorientierten<br />
Abteilungen des DKFZ experimentelle Studien<br />
durchgeführt.<br />
Für diese genannten Aufgaben werden die modernen<br />
Schnittbildtechniken wie Mehrschicht-Spiral-CT, Magnetresonanztomographie,<br />
Magnetresonanz-Spektroskopie,<br />
computerunterstützte Sonographie sowie Farbdoppler-<br />
Sonographie eingesetzt. Technische Verbesserungen<br />
und Innovationen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit<br />
der Abteilung für Medizinische Physik in der Radiologie.<br />
Die klinische Erprobung und kritische Evaluation erfolgt in<br />
Zusammenarbeit mit den Klinischen Kooperationseinheiten<br />
für Strahlentherapie und Nuklearmedizin sowie<br />
den Kliniken des Tumorzentrums Heidelberg/Mannheim.<br />
1 Zentralnervensystem<br />
M. Essig, H.-P. Schlemmer, J. Debus, L. Dukic,<br />
F. Giesel, M. Lichy, C. Rehm, B. Stieltjes, M.A. Weber<br />
1.1 Einleitung<br />
Im Bereich des Zentralnervensystems (ZNS) wurden in den<br />
Jahren 2002 und 2003 mehrere Forschungsschwerpunkte<br />
etabliert oder ausgebaut zum einen der traditionelle<br />
neuroonkologische Schwerpunkt in enger Zusammenarbeit<br />
mit der Klinischen Kooperationseinheit Strahlentherapie im<br />
Hause und der Abteilung Strahlentherapie an der Universitätsklinik.<br />
Weitere Kooperationen bestanden auf diesem<br />
Gebiet mit der Neurochirurgischen Klinik Heidelberg und<br />
den Neurologischen Kliniken Heidelberg und Mannheim.<br />
Neben der Entwicklung weiterer optimierter morphologischer<br />
Verfahren wurden funktionelle Verfahren zunehmend<br />
in die Therapieplanung und in das Therapieverlaufsmonitoring<br />
integriert.<br />
Der Schwerpunkt Gefäßmissbildungen im ZNS hat die Möglichkeiten<br />
der nicht invasiven Schnittbilddiagnostik zerebraler<br />
Gefäßmissbildungen/Erkrankungen über methodische Verfahren<br />
erweitert und auch erste klinische Ergebnisse mit<br />
diesen Verfahren erzielt. Des Weiteren wurden in einer<br />
größeren Studie strahlentherapeutische Ergebnisse der<br />
letzten 5 Jahren evaluiert und entsprechend publiziert.<br />
Die Arbeitsgruppe morphologische und funktionelle Bildgebung<br />
in der Psychiatrie konnte in den entsprechenden<br />
Jahren durchgreifende Ergebnisse in den Bereichen Schizophrenie<br />
und neurodegenerative Erkrankungen erlangen.<br />
Insbesondere der Schwerpunkt Demenzdiagnostik hat sich<br />
deutlich erweitert und wichtige Ergebnisse erzielt. Im Folgenden<br />
werden die einzelnen Schwerpunkte separat beschrieben.<br />
1.2 Neuroonkologie<br />
1.2.1 Morphologie<br />
In einem Teilprojekt wurde bizentrisch der Stellenwert eines<br />
neuartigen MRT-Kontrastmittels (Gadobenate-dimeglumine)<br />
bei 27 Patienten mit hochgradigen Gliomen<br />
oder Hirnmetastasen evaluiert. Dabei wurden die optimale<br />
Kontrastmitteldosis und der optimale Bildaufnahmezeitpunkt<br />
nach Kontrastmittelgabe ermittelt. Das neuartige MRT-Kontrastmittel<br />
ergab dabei in der Standarddosierung einen signifikant<br />
höheren Kontrast von Tumorgewebe verglichen<br />
mit gesundem Hirngewebe als ein Standard MRT-Kontrastmittel<br />
(Gadopentetate-dimeglumine) und vermag so zu<br />
einer besseren Tumorabgrenzung zu verhelfen. Dies ist bei<br />
der Resektions- und Strahlentherapieplanung, sowie beim<br />
frühzeitigen Nachweis einer Tumormalignisierung<br />
niedergradiger Gliome vorteilhaft. [1, 21, 25, 96, 97, 100,<br />
123, 131]<br />
1.2.2 Perfusion<br />
Die Tumorperfusion ist ein wichtiger Parameter bei Differenzialdiagnose<br />
und Therapie-Monitoring von Hirntumoren.<br />
Als Perfusion wird der Blutfluss durch das Kapillarnetz im<br />
Gewebe - die sog. Mikrozirkulation - bezogen auf die Masse<br />
des Gewebes bezeichnet. Methoden zur Bestimmung der<br />
Perfusion beruhen auf der Verabreichung von Trägermolekülen,<br />
sog. „Tracern“. Hierzu eignen sich sowohl endogene<br />
als auch exogene Substanzen, die sich bei ihrer Passage<br />
durch das Kapillarbett eindeutig abgrenzen lassen und<br />
somit eine Quantifizierung der Perfusion erlauben. Heute<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
269