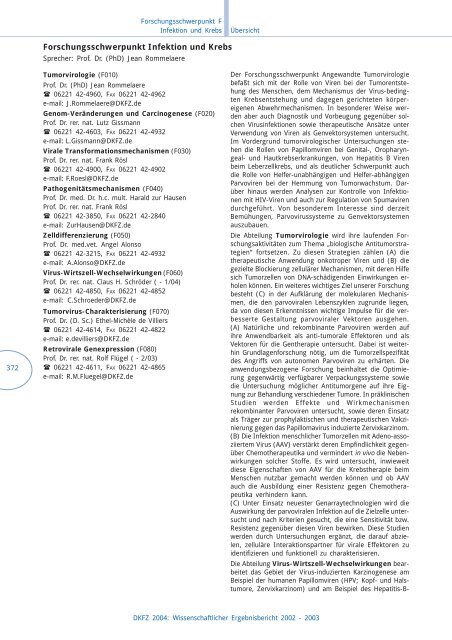MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
372<br />
Forschungsschwerpunkt F<br />
Infektion und Krebs Übersicht<br />
Forschungsschwerpunkt Infektion und Krebs<br />
Sprecher: Prof. Dr. (PhD) Jean Rommelaere<br />
Tumorvirologie (F010)<br />
Prof. Dr. (PhD) Jean Rommelaere<br />
� 06221 42-4960, FAX 06221 42-4962<br />
e-mail: J.Rommelaere@DKFZ.de<br />
Genom-Veränderungen und Carcinogenese (F020)<br />
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Gissmann<br />
� 06221 42-4603, FAX 06221 42-4932<br />
e-mail: L.Gissmann@DKFZ.de<br />
Virale Transformationsmechanismen (F030)<br />
Prof. Dr. rer. nat. Frank Rösl<br />
� 06221 42-4900, FAX 06221 42-4902<br />
e-mail: F.Roesl@DKFZ.de<br />
Pathogenitätsmechanismen (F040)<br />
Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Harald zur Hausen<br />
Prof. Dr. rer. nat. Frank Rösl<br />
� 06221 42-3850, FAX 06221 42-2840<br />
e-mail: ZurHausen@DKFZ.de<br />
Zelldifferenzierung (F050)<br />
Prof. Dr. med.vet. Angel Alonso<br />
� 06221 42-3215, FAX 06221 42-4932<br />
e-mail: A.Alonso@DKFZ.de<br />
Virus-Wirtszell-Wechselwirkungen (F060)<br />
Prof. Dr. rer. nat. Claus H. Schröder ( - 1/04)<br />
� 06221 42-4850, FAX 06221 42-4852<br />
e-mail: C.Schroeder@DKFZ.de<br />
Tumorvirus-Charakterisierung (F070)<br />
Prof. Dr. (D. Sc.) Ethel-Michèle de Villiers<br />
� 06221 42-4614, FAX 06221 42-4822<br />
e-mail: e.devilliers@DKFZ.de<br />
Retrovirale Genexpression (F080)<br />
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Flügel ( - 2/03)<br />
� 06221 42-4611, FAX 06221 42-4865<br />
e-mail: R.M.Fluegel@DKFZ.de<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Der Forschungsschwerpunkt Angewandte Tumorvirologie<br />
befaßt sich mit der Rolle von Viren bei der Tumorentstehung<br />
des Menschen, dem Mechanismus der Virus-bedingten<br />
Krebsentstehung und dagegen gerichteten körpereigenen<br />
Abwehrmechanismen. In besonderer Weise werden<br />
aber auch Diagnostik und Vorbeugung gegenüber solchen<br />
Virusinfektionen sowie therapeutische Ansätze unter<br />
Verwendung von Viren als Genvektorsystemen untersucht.<br />
Im Vordergrund tumorvirologischer Untersuchungen stehen<br />
die Rollen von Papillomviren bei Genital-, Oropharyngeal-<br />
und Hautkrebserkrankungen, von Hepatitis B Viren<br />
beim Leberzellkrebs, und als deutlicher Schwerpunkt auch<br />
die Rolle von Helfer-unabhängigen und Helfer-abhängigen<br />
Parvoviren bei der Hemmung von Tumorwachstum. Darüber<br />
hinaus werden Analysen zur Kontrolle von Infektionen<br />
mit HIV-Viren und auch zur Regulation von Spumaviren<br />
durchgeführt. Von besonderem Interesse sind derzeit<br />
Bemühungen, Parvovirussysteme zu Genvektorsystemen<br />
auszubauen.<br />
Die Abteilung Tumorvirologie wird ihre laufenden Forschungsaktivitäten<br />
zum Thema „biologische Antitumorstrategien“<br />
fortsetzen. Zu diesen Strategien zählen (A) die<br />
therapeutische Anwendung onkotroper Viren und (B) die<br />
gezielte Blockierung zellulärer Mechanismen, mit deren Hilfe<br />
sich Tumorzellen von DNA-schädigenden Einwirkungen erholen<br />
können. Ein weiteres wichtiges Ziel unserer Forschung<br />
besteht (C) in der Aufklärung der molekularen Mechanismen,<br />
die den parvoviralen Lebenszyklen zugrunde liegen,<br />
da von diesen Erkenntnissen wichtige Impulse für die verbesserte<br />
Gestaltung parvoviraler Vektoren ausgehen.<br />
(A) Natürliche und rekombinante Parvoviren werden auf<br />
ihre Anwendbarkeit als anti-tumorale Effektoren und als<br />
Vektoren für die Gentherapie untersucht. Dabei ist weiterhin<br />
Grundlagenforschung nötig, um die Tumorzellspezifität<br />
des Angriffs von autonomen Parvoviren zu erhärten. Die<br />
anwendungsbezogene Forschung beinhaltet die Optimierung<br />
gegenwärtig verfügbarer Verpackungssysteme sowie<br />
die Untersuchung möglicher Antitumorgene auf ihre Eignung<br />
zur Behandlung verschiedener Tumore. In präklinischen<br />
Studien werden Effekte und Wirkmechanismen<br />
rekombinanter Parvoviren untersucht, sowie deren Einsatz<br />
als Träger zur prophylaktischen und therapeutischen Vakzinierung<br />
gegen das Papillomavirus induzierte Zervixkarzinom.<br />
(B) Die Infektion menschlicher Tumorzellen mit Adeno-assoziiertem<br />
Virus (AAV) verstärkt deren Empfindlichkeit gegenüber<br />
Chemotherapeutika und vermindert in vivo die Nebenwirkungen<br />
solcher Stoffe. Es wird untersucht, inwieweit<br />
diese Eigenschaften von AAV für die Krebstherapie beim<br />
Menschen nutzbar gemacht werden können und ob AAV<br />
auch die Ausbildung einer Resistenz gegen Chemotherapeutika<br />
verhindern kann.<br />
(C) Unter Einsatz neuester Genarraytechnologien wird die<br />
Auswirkung der parvoviralen Infektion auf die Zielzelle untersucht<br />
und nach Kriterien gesucht, die eine Sensitivität bzw.<br />
Resistenz gegenüber diesen Viren bewirken. Diese Studien<br />
werden durch Untersuchungen ergänzt, die darauf abzielen,<br />
zelluläre Interaktionspartner für virale Effektoren zu<br />
identifizieren und funktionell zu charakterisieren.<br />
Die Abteilung Virus-Wirtszell-Wechselwirkungen bearbeitet<br />
das Gebiet der Virus-induzierten Karzinogenese am<br />
Beispiel der humanen Papillomviren (HPV; Kopf- und Halstumore,<br />
Zervixkarzinom) und am Beispiel des Hepatitis-B-