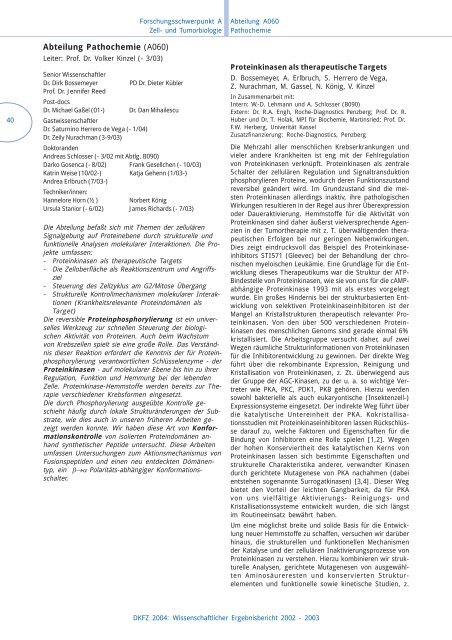MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
40<br />
Abteilung Pathochemie (A060)<br />
Leiter: Prof. Dr. Volker Kinzel (- 3/03)<br />
Forschungsschwerpunkt A<br />
Zell- und Tumorbiologie<br />
Senior Wissenschaftler<br />
Dr. Dirk Bossemeyer PD Dr. Dieter Kübler<br />
Prof. Dr. Jennifer Reed<br />
Post-docs<br />
Dr. Michael Gaßel (01-) Dr. Dan Mihailescu<br />
Gastwissenschaftler<br />
Dr. Saturnino Herrero de Vega (- 1/04)<br />
Dr. Zeily Nurachman (3-9/03)<br />
Doktoranden<br />
Andreas Schlosser (- 3/02 mit Abtlg. B090)<br />
Darko Gosenca (- 8/02) Frank Gesellchen (- 10/03)<br />
Katrin Weise (10/02-) Katja Gehenn (1/03-)<br />
Andrea Erlbruch (7/03-)<br />
Techniker/innen:<br />
Hannelore Horn (½) Norbert König<br />
Ursula Stanior (- 6/02) James Richards (- 7/03)<br />
Die Abteilung befaßt sich mit Themen der zellulären<br />
Signalgebung auf Proteinebene durch strukturelle und<br />
funktionelle Analysen molekularer Interaktionen. Die Projekte<br />
umfassen:<br />
- Proteinkinasen als therapeutische Targets<br />
- Die Zelloberfläche als Reaktionszentrum und Angriffsziel<br />
- Steuerung des Zellzyklus am G2/Mitose Übergang<br />
- Strukturelle Kontrollmechanismen molekularer Interaktionen<br />
(Krankheitsrelevante Proteindomänen als<br />
Target)<br />
Die reversible Proteinphosphorylierung ist ein universelles<br />
Werkzeug zur schnellen Steuerung der biologischen<br />
Aktivität von Proteinen. Auch beim Wachstum<br />
von Krebszellen spielt sie eine große Rolle. Das Verständnis<br />
dieser Reaktion erfordert die Kenntnis der für Proteinphosphorylierung<br />
verantwortlichen Schlüsselenzyme - der<br />
Proteinkinasen - auf molekularer Ebene bis hin zu ihrer<br />
Regulation, Funktion und Hemmung bei der lebenden<br />
Zelle. Proteinkinase-Hemmstoffe werden bereits zur Therapie<br />
verschiedener Krebsformen eingesetzt.<br />
Die durch Phosphorylierung ausgeübte Kontrolle geschieht<br />
häufig durch lokale Strukturänderungen der Substrate,<br />
wie dies auch in unseren früheren Arbeiten gezeigt<br />
werden konnte. Wir haben diese Art von Konformationskontrolle<br />
von isolierten Proteindomänen anhand<br />
synthetischer Peptide untersucht. Diese Arbeiten<br />
umfassen Untersuchungen zum Aktionsmechanismus von<br />
Fusionspeptiden und einen neu entdeckten Dömänentyp,<br />
ein β→α Polaritäts-abhängiger Konformationsschalter.<br />
Abteilung A060<br />
Pathochemie<br />
Proteinkinasen als therapeutische Targets<br />
D. Bossemeyer, A. Erlbruch, S. Herrero de Vega,<br />
Z. Nurachman, M. Gassel, N. König, V. Kinzel<br />
In Zusammenarbeit mit:<br />
Intern: W.-D. Lehmann und A. Schlosser (B090)<br />
Extern: Dr. R.A. Engh, Roche-Diagnostics Penzberg; Prof. Dr. R.<br />
Huber und Dr. T. Holak, MPI für Biochemie, Martinsried; Prof. Dr.<br />
F.W. Herberg, Univerität Kassel<br />
Zusatzfinanzierung: Roche-Diagnostics, Penzberg<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
Die Mehrzahl aller menschlichen Krebserkrankungen und<br />
vieler andere Krankheiten ist eng mit der Fehlregulation<br />
von Proteinkinasen verknüpft. Proteinkinasen als zentrale<br />
Schalter der zellulären Regulation und Signaltransduktion<br />
phosphorylieren Proteine, wodurch deren Funktionszustand<br />
reversibel geändert wird. Im Grundzustand sind die meisten<br />
Proteinkinasen allerdings inaktiv, ihre pathologischen<br />
Wirkungen resultieren in der Regel aus ihrer Überexpression<br />
oder Daueraktivierung. Hemmstoffe für die Aktivität von<br />
Proteinkinasen sind daher äußerst vielversprechende Agenzien<br />
in der Tumortherapie mit z. T. überwältigenden therapeutischen<br />
Erfolgen bei nur geringen Nebenwirkungen.<br />
Dies zeigt eindrucksvoll das Beispiel des Proteinkinaseinhibitors<br />
STI571 (Gleevec) bei der Behandlung der chronischen<br />
myeloischen Leukämie. Eine Grundlage für die Entwicklung<br />
dieses Therapeutikums war die Struktur der ATP-<br />
Bindestelle von Proteinkinasen, wie sie von uns für die cAMPabhängige<br />
Proteinkinase 1993 mit als erstes vorgelegt<br />
wurde. Ein großes Hindernis bei der strukturbasierten Entwicklung<br />
von selektiven Proteinkinaseinhibitoren ist der<br />
Mangel an Kristallstrukturen therapeutisch relevanter Proteinkinasen.<br />
Von den über 500 verschiedenen Proteinkinasen<br />
des menschlichen Genoms sind gerade einmal 6%<br />
kristallisiert. Die Arbeitsgruppe versucht daher, auf zwei<br />
Wegen räumliche Strukturinformationen von Proteinkinasen<br />
für die Inhibitorentwicklung zu gewinnen. Der direkte Weg<br />
führt über die rekombinante Expression, Reinigung und<br />
Kristallisation von Proteinkinasen, z. Zt. überwiegend aus<br />
der Gruppe der AGC-Kinasen, zu der u. a. so wichtige Vertreter<br />
wie PKA, PKC, PDK1, PKB gehören. Hierzu werden<br />
sowohl bakterielle als auch eukaryontische (Insektenzell-)<br />
Expressionsysteme eingesetzt. Der indirekte Weg führt über<br />
die katalytische Untereinheit der PKA. Kokristallisationsstudien<br />
mit Proteinkinaseinhibitoren lassen Rückschlüsse<br />
darauf zu, welche Faktoren und Eigenschaften für die<br />
Bindung von Inhibitoren eine Rolle spielen [1,2]. Wegen<br />
der hohen Konserviertheit des katalytischen Kerns von<br />
Proteinkinasen lassen sich bestimmte Eigenschaften und<br />
strukturelle Charakteristika anderer, verwandter Kinasen<br />
durch gerichtete Mutagenese von PKA nachahmen (dabei<br />
entstehen sogenannte Surrogatkinasen) [3,4]. Dieser Weg<br />
bietet den Vorteil der leichten Gangbarkeit, da für PKA<br />
von uns vielfältige Aktivierungs- Reinigungs- und<br />
Kristallisationssysteme entwickelt wurden, die sich längst<br />
im Routineeinsatz bewährt haben.<br />
Um eine möglichst breite und solide Basis für die Entwicklung<br />
neuer Hemmstoffe zu schaffen, versuchen wir darüber<br />
hinaus, die strukturellen und funktionellen Mechanismen<br />
der Katalyse und der zellulären Inaktivierungsprozesse von<br />
Proteinkinasen zu verstehen. Hierzu kombinieren wir strukturelle<br />
Analysen, gerichtete Mutagenesen von ausgewählten<br />
Aminosäureresten und konservierten Strukturelementen<br />
und funktionelle sowie kinetische Studien, z.