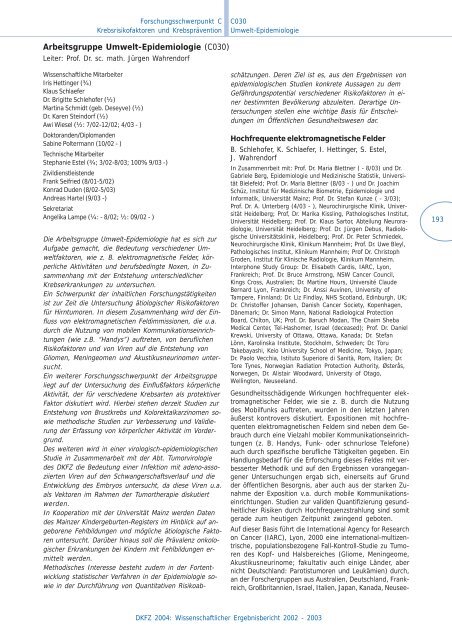MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention<br />
Arbeitsgruppe Umwelt-Epidemiologie (C030)<br />
Leiter: Prof. Dr. sc. math. Jürgen Wahrendorf<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Iris Hettinger (¾)<br />
Klaus Schlaefer<br />
Dr. Brigitte Schlehofer (½)<br />
Martina Schmidt (geb. Deseyve) (½)<br />
Dr. Karen Steindorf (½)<br />
Awi Wiesel (½: 7/02-12/02; 4/03 - )<br />
Doktoranden/Diplomanden<br />
Sabine Poltermann (10/02 - )<br />
Technische Mitarbeiter<br />
Stephanie Estel (¾; 3/02-8/03; 100% 9/03 -)<br />
Zivildienstleistende<br />
Frank Seifried (8/01-5/02)<br />
Konrad Duden (8/02-5/03)<br />
Andreas Hartel (9/03 -)<br />
Sekretariat<br />
Angelika Lampe (¼: - 8/02; ½: 09/02 - )<br />
Die Arbeitsgruppe Umwelt-Epidemiologie hat es sich zur<br />
Aufgabe gemacht, die Bedeutung verschiedener Umweltfaktoren,<br />
wie z. B. elektromagnetische Felder, körperliche<br />
Aktivitäten und berufsbedingte Noxen, in Zusammenhang<br />
mit der Entstehung unterschiedlicher<br />
Krebserkrankungen zu untersuchen.<br />
Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Forschungstätigkeiten<br />
ist zur Zeit die Untersuchung ätiologischer Risikofaktoren<br />
für Hirntumoren. In diesem Zusammenhang wird der Einfluss<br />
von elektromagnetischen Feldimmissionen, die u.a.<br />
durch die Nutzung von mobilen Kommunikationseinrichtungen<br />
(wie z.B. “Handys”) auftreten, von beruflichen<br />
Risikofaktoren und von Viren auf die Entstehung von<br />
Gliomen, Meningeomen und Akustikusneurinomen untersucht.<br />
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe<br />
liegt auf der Untersuchung des Einflußfaktors körperliche<br />
Aktivität, der für verschiedene Krebsarten als protektiver<br />
Faktor diskutiert wird. Hierbei stehen derzeit Studien zur<br />
Entstehung von Brustkrebs und Kolorektalkarzinomen sowie<br />
methodische Studien zur Verbesserung und Validierung<br />
der Erfassung von körperlicher Aktivität im Vordergrund.<br />
Des weiteren wird in einer virologisch-epidemiologischen<br />
Studie in Zusammenarbeit mit der Abt. Tumorvirologie<br />
des DKFZ die Bedeutung einer Infektion mit adeno-assoziierten<br />
Viren auf den Schwangerschaftsverlauf und die<br />
Entwicklung des Embryos untersucht, da diese Viren u.a.<br />
als Vektoren im Rahmen der Tumortherapie diskutiert<br />
werden.<br />
In Kooperation mit der Universität Mainz werden Daten<br />
des Mainzer Kindergeburten-Registers im Hinblick auf angeborene<br />
Fehlbildungen und mögliche ätiologische Faktoren<br />
untersucht. Darüber hinaus soll die Prävalenz onkologischer<br />
Erkrankungen bei Kindern mit Fehlbildungen ermittelt<br />
werden.<br />
Methodisches Interesse besteht zudem in der Fortentwicklung<br />
statistischer Verfahren in der Epidemiologie sowie<br />
in der Durchführung von Quantitativen Risikoab-<br />
C030<br />
Umwelt-Epidemiologie<br />
schätzungen. Deren Ziel ist es, aus den Ergebnissen von<br />
epidemiologischen Studien konkrete Aussagen zu dem<br />
Gefährdungspotential verschiedener Risikofaktoren in einer<br />
bestimmten Bevölkerung abzuleiten. Derartige Untersuchungen<br />
stellen eine wichtige Basis für Entscheidungen<br />
im Öffentlichen Gesundheitswesen dar.<br />
Hochfrequente elektromagnetische Felder<br />
B. Schlehofer, K. Schlaefer, I. Hettinger, S. Estel,<br />
J. Wahrendorf<br />
In Zusammenrbeit mit: Prof. Dr. Maria Blettner ( - 8/03) und Dr.<br />
Gabriele Berg, Epidemiologie und Medizinische Statistik, Universität<br />
Bielefeld; Prof. Dr. Maria Blettner (8/03 - ) und Dr. Joachim<br />
Schüz, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und<br />
Informatik, Universität Mainz; Prof. Dr. Stefan Kunze ( - 3/03);<br />
Prof. Dr. A. Unterberg (4/03 - ), Neurochirurgische Klinik, Universität<br />
Heidelberg; Prof, Dr. Marika Kissling, Pathologisches Institut,<br />
Universität Heidelberg; Prof. Dr. Klaus Sartor, Abteilung Neuroradiologie,<br />
Universität Heidelberg; Prof. Dr. Jürgen Debus, Radiologische<br />
Universitätsklinik, Heidelberg; Prof. Dr. Peter Schmiedek,<br />
Neurochirurgische Klinik, Klinikum Mannheim; Prof. Dr. Uwe Bleyl,<br />
Pathologisches Institut, Klinikum Mannheim; Prof Dr. Christoph<br />
Groden, Institut für Klinische Radiologie, Klinikum Mannheim.<br />
Interphone Study Group: Dr. Elisabeth Cardis, IARC, Lyon,<br />
Frankreich; Prof. Dr. Bruce Armstrong, NSW Cancer Council,<br />
Kings Cross, Australien; Dr. Martine Hours, Université Claude<br />
Bernard Lyon, Frankreich; Dr. Anssi Auvinen, University of<br />
Tampere, Finnland; Dr. Liz Findlay, NHS Scotland, Edinburgh, UK;<br />
Dr. Christoffer Johansen, Danish Cancer Society, Kopenhagen,<br />
Dänemark; Dr. Simon Mann, National Radiological Protection<br />
Board, Chilton, UK; Prof. Dr. Baruch Modan, The Chaim Sheba<br />
Medical Center, Tel-Hashomer, Israel (deceased); Prof. Dr. Daniel<br />
Krewski, University of Ottawa, Ottawa, Kanada; Dr. Stefan<br />
Lönn, Karolinska Institute, Stockholm, Schweden; Dr. Toru<br />
Takebayashi, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan;<br />
Dr. Paolo Vecchia, Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien; Dr.<br />
Tore Tynes, Norwegian Radiation Protection Authority, Østerås,<br />
Norwegen, Dr. Alistair Woodward, University of Otago,<br />
Wellington, Neuseeland.<br />
Gesundheitsschädigende Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer<br />
Felder, wie sie z. B. durch die Nutzung<br />
des Mobilfunks auftreten, wurden in den letzten Jahren<br />
äußerst kontrovers diskutiert. Expositionen mit hochfrequenten<br />
elektromagnetischen Feldern sind neben dem Gebrauch<br />
durch eine Vielzahl mobiler Kommunikationseinrichtungen<br />
(z. B. Handys, Funk- oder schnurlose Telefone)<br />
auch durch spezifische berufliche Tätigkeiten gegeben. Ein<br />
Handlungsbedarf für die Erforschung dieses Feldes mit verbesserter<br />
Methodik und auf den Ergebnissen vorangegangener<br />
Untersuchungen ergab sich, einerseits auf Grund<br />
der öffentlichen Besorgnis, aber auch aus der starken Zunahme<br />
der Exposition v.a. durch mobile Kommunikationseinrichtungen.<br />
Studien zur validen Quantifizierung gesundheitlicher<br />
Risiken durch Hochfrequenzstrahlung sind somit<br />
gerade zum heutigen Zeitpunkt zwingend geboten.<br />
Auf dieser Basis führt die International Agency for Research<br />
on Cancer (IARC), Lyon, 2000 eine international-multizentrische,<br />
populationsbezogene Fall-Kontroll-Studie zu Tumoren<br />
des Kopf- und Halsbereiches (Gliome, Meningeome,<br />
Akustikusneurinome; fakultativ auch einige Länder, aber<br />
nicht Deutschland: Parotistumoren und Leukämien) durch,<br />
an der Forschergruppen aus Australien, Deutschland, Frankreich,<br />
Großbritannien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neusee-<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
193