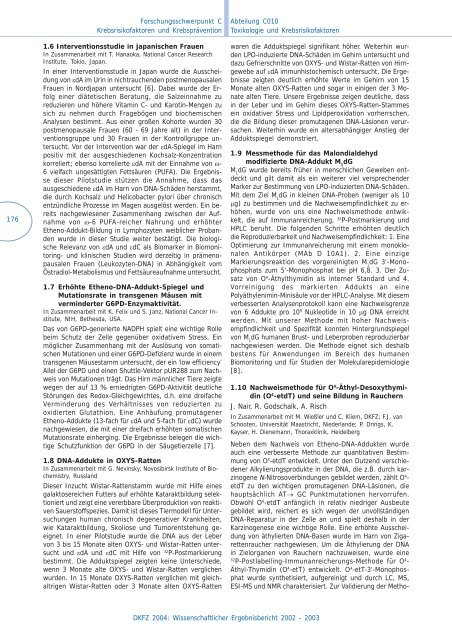MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
176<br />
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention<br />
1.6 Interventionsstudie in japanischen Frauen<br />
In Zusammenarbeit mit T. Hanaoka, National Cancer Research<br />
Institute, Tokio, Japan.<br />
In einer Interventionsstudie in Japan wurde die Ausscheidung<br />
von εdA im Urin in nichtrauchenden postmenopausalen<br />
Frauen in Nordjapan untersucht [6]. Dabei wurde der Erfolg<br />
einer diätetischen Beratung, die Salzeinnahme zu<br />
reduzieren und höhere Vitamin C- und Karotin-Mengen zu<br />
sich zu nehmen durch Fragebögen und biochemischen<br />
Analysen bestimmt. Aus einer großen Kohorte wurden 30<br />
postmenopausale Frauen (60 - 69 Jahre alt) in der Interventionsgruppe<br />
und 30 Frauen in der Kontrollgruppe untersucht.<br />
Vor der Intervention war der εdA-Spiegel im Harn<br />
positiv mit der ausgeschiedenen Kochsalz-Konzentration<br />
korreliert; ebenso korrelierte εdA mit der Einnahme von ω-<br />
6 vielfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA). Die Ergebnisse<br />
dieser Pilotstudie stützen die Annahme, dass das<br />
ausgeschiedene εdA im Harn von DNA-Schäden herstammt,<br />
die durch Kochsalz und Helicobacter pylori über chronisch<br />
entzündliche Prozesse im Magen ausgelöst werden. Ein bereits<br />
nachgewiesener Zusammenhang zwischen der Aufnahme<br />
von ω-6 PUFA-reicher Nahrung und erhöhter<br />
Etheno-Addukt-Bildung in Lymphozyten weiblicher Probanden<br />
wurde in dieser Studie weiter bestätigt. Die biologische<br />
Relevanz von εdA und εdC als Biomarker in Biomonitoring-<br />
und klinischen Studien wird derzeitig in prämenopausalen<br />
Frauen (Leukozyten-DNA) in Abhängigkeit vom<br />
Östradiol-Metabolismus und Fettsäureaufnahme untersucht.<br />
1.7 Erhöhte Etheno-DNA-Addukt-Spiegel und<br />
Mutationsrate in transgenen Mäusen mit<br />
verminderter G6PD-Enzymaktivität.<br />
In Zusammenarbeit mit K. Felix und S. Janz, National Cancer Institute,<br />
NIH, Bethesda, USA.<br />
Das von G6PD-generierte NADPH spielt eine wichtige Rolle<br />
beim Schutz der Zelle gegenüber oxidativem Stress. Ein<br />
möglicher Zusammenhang mit der Auslösung von somatischen<br />
Mutationen und einer G6PD-Defizienz wurde in einem<br />
transgenen Mäusestamm untersucht, der ein ‘low efficiency’<br />
Allel der G6PD und einen Shuttle-Vektor pUR288 zum Nachweis<br />
von Mutationen trägt. Das Hirn männlicher Tiere zeigte<br />
wegen der auf 13 % erniedrigten G6PD-Aktivität deutliche<br />
Störungen des Redox-Gleichgewichtes, d.h. eine dreifache<br />
Verminderung des Verhältnisses von reduzierten zu<br />
oxidierten Glutathion. Eine Anhäufung promutagener<br />
Etheno-Addukte (13-fach für εdA und 5-fach für εdC) wurde<br />
nachgewiesen, die mit einer dreifach erhöhten somatischen<br />
Mutationsrate einherging. Die Ergebnisse belegen die wichtige<br />
Schutzfunktion der G6PD in der Säugetierzelle [7].<br />
1.8 DNA-Addukte in OXYS-Ratten<br />
In Zusammenarbeit mit G. Nevinsky, Novosibirsk Institute of Biochemistry,<br />
Russland<br />
Dieser Inzucht Wistar-Rattenstamm wurde mit Hilfe eines<br />
galaktosereichen Futters auf erhöhte Kataraktbildung selektioniert<br />
und zeigt eine vererbbare Überproduktion von reaktiven<br />
Sauerstoffspezies. Damit ist dieses Tiermodell für Untersuchungen<br />
human chronisch degenerativer Krankheiten,<br />
wie Kataraktbildung, Skoliose und Tumorentstehung geeignet.<br />
In einer Pilotstudie wurde die DNA aus der Leber<br />
von 3 bis 15 Monate alten OXYS- und Wistar-Ratten untersucht<br />
und εdA und εdC mit Hilfe von 32P-Postmarkierung bestimmt. Die Adduktspiegel zeigten keine Unterschiede,<br />
wenn 3 Monate alte OXYS- und Wistar-Ratten verglichen<br />
wurden. In 15 Monate OXYS-Ratten verglichen mit gleichaltrigen<br />
Wistar-Ratten oder 3 Monate alten OXYS-Ratten<br />
Abteilung C010<br />
Toxikologie und Krebsrisikofaktoren<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
waren die Adduktspiegel signifikant höher. Weiterhin wurden<br />
LPO-induzierte DNA-Schäden im Gehirn untersucht und<br />
dazu Gefrierschnitte von OXYS- und Wistar-Ratten von Hirngewebe<br />
auf εdA immunhistochemisch untersucht. Die Ergebnisse<br />
zeigten deutlich erhöhte Werte im Gehirn von 15<br />
Monate alten OXYS-Ratten und sogar in einigen der 3 Monate<br />
alten Tiere. Unsere Ergebnisse zeigen deutliche, dass<br />
in der Leber und im Gehirn dieses OXYS-Ratten-Stammes<br />
ein oxidativer Stress und Lipidperoxidation vorherrschen,<br />
die die Bildung dieser promutagenen DNA-Läsionen verursachen.<br />
Weiterhin wurde ein altersabhängiger Anstieg der<br />
Adduktspiegel demonstriert.<br />
1.9 Messmethode für das Malondialdehyd<br />
modifizierte DNA-Addukt M 1 dG<br />
M 1 dG wurde bereits früher in menschlichen Geweben entdeckt<br />
und gilt damit als ein weiterer viel versprechender<br />
Marker zur Bestimmung von LPO-induzierten DNA-Schäden.<br />
Mit dem Ziel M 1 dG in kleinen DNA-Proben (weniger als 10<br />
µg) zu bestimmen und die Nachweisempfindlichkeit zu erhöhen,<br />
wurde von uns eine Nachweismethode entwikkelt,<br />
die auf Immunanreicherung, 32 P-Postmarkierung und<br />
HPLC beruht. Die folgenden Schritte erhöhten deutlich<br />
die Reproduzierbarkeit und Nachweisempfindlichkeit: 1. Eine<br />
Optimierung zur Immunanreicherung mit einem monoklonalen<br />
Antikörper (MAb D 10A1). 2. Eine einzige<br />
Markierungsreaktion des vorgereinigten M 1 dG 3'-Monophosphats<br />
zum 5'-Monophosphat bei pH 6,8. 3. Der Zusatz<br />
von O 4 -Äthylthymidin als interner Standard und 4.<br />
Vorreinigung des markierten Addukts an eine<br />
Polyäthylenimin-Minisäule vor der HPLC-Analyse. Mit diesem<br />
verbesserten Analysenprotokoll kann eine Nachweisgrenze<br />
von 6 Addukte pro 10 9 Nukleotide in 10 µg DNA erreicht<br />
werden. Mit unserer Methode mit hoher Nachweisempfindlichkeit<br />
und Spezifität konnten Hintergrundspiegel<br />
von M 1 dG humanen Brust- und Leberproben reproduzierbar<br />
nachgewiesen werden. Die Methode eignet sich deshalb<br />
bestens für Anwendungen im Bereich des humanen<br />
Biomonitoring und für Studien der Molekularepidemiologie<br />
[8].<br />
1.10 Nachweismethode für O4-Äthyl-Desoxythymi din (O4-etdT) und seine Bildung in Rauchern<br />
J. Nair, R. Godschalk, A. Risch<br />
In Zusammenarbeit mit M. Wießler und C. Kliem, DKFZ; F.J. van<br />
Schooten, Universität Maastricht, Niederlande; P. Drings, K.<br />
Kayser, H. Dienemann, Thoraxklinik, Heidelberg<br />
Neben dem Nachweis von Etheno-DNA-Addukten wurde<br />
auch eine verbesserte Methode zur quantitativen Bestimmung<br />
von O 4 -etdT entwickelt. Unter den Dutzend verschiedener<br />
Alkylierungsprodukte in der DNA, die z.B. durch karzinogene<br />
N-Nitrosoverbindungen gebildet werden, zählt O 4 -<br />
etdT zu den wichtigen promutagenen DNA-Läsionen, die<br />
hauptsächlich AT→ GC Punktmutationen hervorrufen.<br />
Obwohl O 4 -etdT anfänglich in relativ niedriger Ausbeute<br />
gebildet wird, reichert es sich wegen der unvollständigen<br />
DNA-Reparatur in der Zelle an und spielt deshalb in der<br />
Karzinogenese eine wichtige Rolle. Eine erhöhte Ausscheidung<br />
von äthylierten DNA-Basen wurde im Harn von Zigarettenraucher<br />
nachgewiesen. Um die Äthylierung der DNA<br />
in Zielorganen von Rauchern nachzuweisen, wurde eine<br />
32 P-Postlabelling-Immunanreicherungs-Methode für O 4 -<br />
Äthyl-Thymidin (O 4 -etT) entwickelt. O 4 -etT-3'-Monophosphat<br />
wurde synthetisiert, aufgereinigt und durch LC, MS,<br />
ESI-MS und NMR charakterisiert. Zur Validierung der Metho-