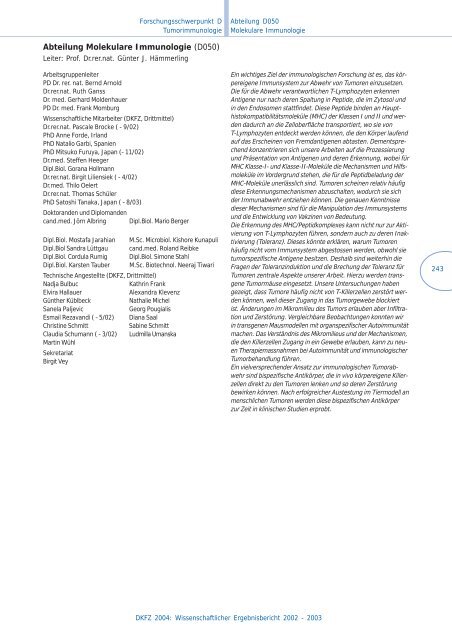MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt D<br />
Tumorimmunologie<br />
Abteilung Molekulare Immunologie (D050)<br />
Leiter: Prof. Dr.rer.nat. Günter J. Hämmerling<br />
Arbeitsgruppenleiter<br />
PD Dr. rer. nat. Bernd Arnold<br />
Dr.rer.nat. Ruth Ganss<br />
Dr. med. Gerhard Moldenhauer<br />
PD Dr. med. Frank Momburg<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter (DKFZ, Drittmittel)<br />
Dr.rer.nat. Pascale Brocke ( - 9/02)<br />
PhD Anne Forde, Irland<br />
PhD Natalio Garbi, Spanien<br />
PhD Mitsuko Furuya, Japan (- 11/02)<br />
Dr.med. Steffen Heeger<br />
Dipl.Biol. Gorana Hollmann<br />
Dr.rer.nat. Birgit Liliensiek ( - 4/02)<br />
Dr.med. Thilo Oelert<br />
Dr.rer.nat. Thomas Schüler<br />
PhD Satoshi Tanaka, Japan ( - 8/03)<br />
Doktoranden und Diplomanden<br />
cand.med. Jörn Albring Dipl.Biol. Mario Berger<br />
Dipl.Biol. Mostafa Jarahian M.Sc. Microbiol. Kishore Kunapuli<br />
Dipl.Biol Sandra Lüttgau cand.med. Roland Reibke<br />
Dipl.Biol. Cordula Rumig Dipl.Biol. Simone Stahl<br />
Dipl.Biol. Karsten Tauber M.Sc. Biotechnol. Neeraj Tiwari<br />
Technische Angestellte (DKFZ, Drittmittel)<br />
Nadja Bulbuc Kathrin Frank<br />
Elvira Hallauer Alexandra Klevenz<br />
Günther Küblbeck Nathalie Michel<br />
Sanela Paljevic Georg Pougialis<br />
Esmail Rezavandi ( - 5/02) Diana Saal<br />
Christine Schmitt Sabine Schmitt<br />
Claudia Schumann ( - 3/02)<br />
Martin Wühl<br />
Sekretariat<br />
Birgit Vey<br />
Ludmilla Umanska<br />
Abteilung D050<br />
Molekulare Immunologie<br />
Ein wichtiges Ziel der immunologischen Forschung ist es, das körpereigene<br />
Immunsystem zur Abwehr von Tumoren einzusetzen.<br />
Die für die Abwehr verantwortlichen T-Lymphozyten erkennen<br />
Antigene nur nach deren Spaltung in Peptide, die im Zytosol und<br />
in den Endosomen stattfindet. Diese Peptide binden an Haupthistokompatibilitätsmoleküle<br />
(MHC) der Klassen I und II und werden<br />
dadurch an die Zelloberfläche transportiert, wo sie von<br />
T-Lymphozyten entdeckt werden können, die den Körper laufend<br />
auf das Erscheinen von Fremdantigenen abtasten. Dementsprechend<br />
konzentrieren sich unsere Arbeiten auf die Prozessierung<br />
und Präsentation von Antigenen und deren Erkennung, wobei für<br />
MHC Klasse-I- und Klasse-II-Moleküle die Mechanismen und Hilfsmoleküle<br />
im Vordergrund stehen, die für die Peptidbeladung der<br />
MHC-Moleküle unerlässlich sind. Tumoren scheinen relativ häufig<br />
diese Erkennungsmechanismen abzuschalten, wodurch sie sich<br />
der Immunabwehr entziehen können. Die genauen Kenntnisse<br />
dieser Mechanismen sind für die Manipulation des Immunsystems<br />
und die Entwicklung von Vakzinen von Bedeutung.<br />
Die Erkennung des MHC/Peptidkomplexes kann nicht nur zur Aktivierung<br />
von T-Lymphozyten führen, sondern auch zu deren Inaktivierung<br />
(Toleranz). Dieses könnte erklären, warum Tumoren<br />
häufig nicht vom Immunsystem abgestossen werden, obwohl sie<br />
tumorspezifische Antigene besitzen. Deshalb sind weiterhin die<br />
Fragen der Toleranzinduktion und die Brechung der Toleranz für<br />
Tumoren zentrale Aspekte unserer Arbeit. Hierzu werden transgene<br />
Tumormäuse eingesetzt. Unsere Untersuchungen haben<br />
gezeigt, dass Tumore häufig nicht von T-Killerzellen zerstört werden<br />
können, weil dieser Zugang in das Tumorgewebe blockiert<br />
ist. Änderungen im Mikromilieu des Tumors erlauben aber Infiltration<br />
und Zerstörung. Vergleichbare Beobachtungen konnten wir<br />
in transgenen Mausmodellen mit organspezifischer Autoimmunität<br />
machen. Das Verständnis des Mikromilieus und der Mechanismen,<br />
die den Killerzellen Zugang in ein Gewebe erlauben, kann zu neuen<br />
Therapiemassnahmen bei Autoimmunität und immunologischer<br />
Tumorbehandlung führen.<br />
Ein vielversprechender Ansatz zur immunologischen Tumorabwehr<br />
sind bispezifische Antikörper, die in vivo körpereigene Killerzellen<br />
direkt zu den Tumoren lenken und so deren Zerstörung<br />
bewirken können. Nach erfolgreicher Austestung im Tiermodell an<br />
menschlichen Tumoren werden diese bispezifischen Antikörper<br />
zur Zeit in klinischen Studien erprobt.<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
243