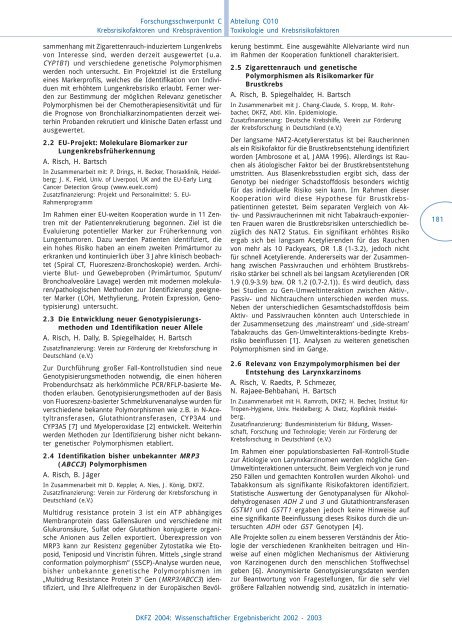MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsschwerpunkt C<br />
Krebsrisikofaktoren und Krebsprävention<br />
sammenhang mit Zigarettenrauch-induziertem Lungenkrebs<br />
von Interesse sind, werden derzeit ausgewertet (u.a.<br />
CYP1B1) und verschiedene genetische Polymorphismen<br />
werden noch untersucht. Ein Projektziel ist die Erstellung<br />
eines Markerprofils, welches die Identifikation von Individuen<br />
mit erhöhtem Lungenkrebsrisiko erlaubt. Ferner werden<br />
zur Bestimmung der möglichen Relevanz genetischer<br />
Polymorphismen bei der Chemotherapiesensitivität und für<br />
die Prognose von Bronchialkarzinompatienten derzeit weiterhin<br />
Probanden rekrutiert und klinische Daten erfasst und<br />
ausgewertet.<br />
2.2 EU-Projekt: Molekulare Biomarker zur<br />
Lungenkrebsfrüherkennung<br />
A. Risch, H. Bartsch<br />
In Zusammenarbeit mit: P. Drings, H. Becker, Thoraxklinik, Heidelberg;<br />
J. K. Field, Univ. of Liverpool, UK and the EU-Early Lung<br />
Cancer Detection Group (www.euelc.com)<br />
Zusatzfinanzierung: Projekt und Personalmittel: 5. EU-<br />
Rahmenprogramm<br />
Im Rahmen einer EU-weiten Kooperation wurde in 11 Zentren<br />
mit der Patientenrekrutierung begonnen. Ziel ist die<br />
Evaluierung potentieller Marker zur Früherkennung von<br />
Lungentumoren. Dazu werden Patienten identifiziert, die<br />
ein hohes Risiko haben an einem zweiten Primärtumor zu<br />
erkranken und kontinuierlich über 3 Jahre klinisch beobachtet<br />
(Spiral CT, Fluoreszenz-Bronchoskopie) werden. Archivierte<br />
Blut- und Gewebeproben (Primärtumor, Sputum/<br />
Bronchoalveoläre Lavage) werden mit modernen molekularen/pathologischen<br />
Methoden zur Identifizierung geeigneter<br />
Marker (LOH, Methylierung, Protein Expression, Genotypisierung)<br />
untersucht.<br />
2.3 Die Entwicklung neuer Genotypisierungsmethoden<br />
und Identifikation neuer Allele<br />
A. Risch, H. Dally, B. Spiegelhalder, H. Bartsch<br />
Zusatzfinanzierung: Verein zur Förderung der Krebsforschung in<br />
Deutschland (e.V.)<br />
Zur Durchführung großer Fall-Kontrollstudien sind neue<br />
Genotypisierungsmethoden notwendig, die einen höheren<br />
Probendurchsatz als herkömmliche PCR/RFLP-basierte Methoden<br />
erlauben. Genotypisierungsmethoden auf der Basis<br />
von Fluoreszenz-basierter Schmelzkurvenanalyse wurden für<br />
verschiedene bekannte Polymorphismen wie z.B. in N-Acetyltransferasen,<br />
Glutathiontransferasen, CYP3A4 und<br />
CYP3A5 [7] und Myeloperoxidase [2] entwickelt. Weiterhin<br />
werden Methoden zur Identifizierung bisher nicht bekannter<br />
genetischer Polymorphismen etabliert.<br />
2.4 Identifikation bisher unbekannter MRP3<br />
(ABCC3) Polymorphismen<br />
A. Risch, B. Jäger<br />
In Zusammenarbeit mit D. Keppler, A. Nies, J. König, DKFZ.<br />
Zusatzfinanzierung: Verein zur Förderung der Krebsforschung in<br />
Deutschland (e.V.)<br />
Multidrug resistance protein 3 ist ein ATP abhängiges<br />
Membranprotein dass Gallensäuren und verschiedene mit<br />
Glukuronsäure, Sulfat oder Glutathion konjugierte organische<br />
Anionen aus Zellen exportiert. Überexpression von<br />
MRP3 kann zur Resistenz gegenüber Zytostatika wie Etoposid,<br />
Teniposid und Vincristin führen. Mittels „single strand<br />
conformation polymorphism“ (SSCP)-Analyse wurden neue,<br />
bisher unbekannte genetische Polymorphismen im<br />
„Multidrug Resistance Protein 3“ Gen (MRP3/ABCC3) identifiziert,<br />
und Ihre Allelfrequenz in der Europäischen Bevöl-<br />
Abteilung C010<br />
Toxikologie und Krebsrisikofaktoren<br />
kerung bestimmt. Eine ausgewählte Allelvariante wird nun<br />
im Rahmen der Kooperation funktionell charakterisiert.<br />
2.5 Zigarettenrauch und genetische<br />
Polymorphismen als Risikomarker für<br />
Brustkrebs<br />
A. Risch, B. Spiegelhalder, H. Bartsch<br />
In Zusammenarbeit mit J. Chang-Claude, S. Kropp, M. Rohrbacher,<br />
DKFZ, Abtl. Klin. Epidemiologie.<br />
Zusatzfinanzierung: Deutsche Krebshilfe, Verein zur Förderung<br />
der Krebsforschung in Deutschland (e.V.)<br />
Der langsame NAT2-Acetyliererstatus ist bei Raucherinnen<br />
als ein Risikofaktor für die Brustkrebsentstehung identifiziert<br />
worden [Ambrosone et al, JAMA 1996). Allerdings ist Rauchen<br />
als ätiologischer Faktor bei der Brustkrebsentstehung<br />
umstritten. Aus Blasenkrebsstudien ergibt sich, dass der<br />
Genotyp bei niedriger Schadstoffdosis besonders wichtig<br />
für das individuelle Risiko sein kann. Im Rahmen dieser<br />
Kooperation wird diese Hypothese für Brustkrebspatientinnen<br />
getestet. Beim separaten Vergleich von Aktiv-<br />
und Passivraucherinnen mit nicht Tabakrauch-exponierten<br />
Frauen waren die Brustkrebsrisiken unterschiedlich bezüglich<br />
des NAT2 Status. Ein signifikant erhöhtes Risiko<br />
ergab sich bei langsam Acetylierenden für das Rauchen<br />
von mehr als 10 Packyears, OR 1.8 (1-3.2), jedoch nicht<br />
für schnell Acetylierende. Andererseits war der Zusammenhang<br />
zwischen Passivrauchen und erhöhtem Brustkrebsrisiko<br />
stärker bei schnell als bei langsam Acetylierenden (OR<br />
1.9 (0.9-3.9) bzw. OR 1.2 (0.7-2.1)). Es wird deutlich, dass<br />
bei Studien zu Gen-Umweltinteraktion zwischen Aktiv-,<br />
Passiv- und Nichtrauchern unterschieden werden muss.<br />
Neben der unterschiedlichen Gesamtschadstoffdosis beim<br />
Aktiv- und Passivrauchen könnten auch Unterschiede in<br />
der Zusammensetzung des ‚mainstream’ und ‚side-stream’<br />
Tabakrauchs das Gen-Umweltinteraktions-bedingte Krebsrisiko<br />
beeinflussen [1]. Analysen zu weiteren genetischen<br />
Polymorphismen sind im Gange.<br />
2.6 Relevanz von Enzympolymorphismen bei der<br />
Entstehung des Larynxkarzinoms<br />
A. Risch, V. Raedts, P. Schmezer,<br />
N. Rajaee-Behbahani, H. Bartsch<br />
In Zusammenarbeit mit H. Ramroth, DKFZ; H. Becher, Institut für<br />
Tropen-Hygiene, Univ. Heidelberg; A. Dietz, Kopfklinik Heidelberg.<br />
Zusatzfinanzierung: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft,<br />
Forschung und Technologie; Verein zur Förderung der<br />
Krebsforschung in Deutschland (e.V.)<br />
Im Rahmen einer populationsbasierten Fall-Kontroll-Studie<br />
zur Ätiologie von Larynxkarzinomen werden mögliche Gen-<br />
Umweltinteraktionen untersucht. Beim Vergleich von je rund<br />
250 Fällen und gemachten Kontrollen wurden Alkohol- und<br />
Tabakkonsum als signifikante Risikofaktoren identifiziert.<br />
Statistische Auswertung der Genotypanalysen für Alkoholdehydrogenasen<br />
ADH 2 und 3 und Glutathiontransferasen<br />
GSTM1 und GSTT1 ergaben jedoch keine Hinweise auf<br />
eine signifikante Beeinflussung dieses Risikos durch die untersuchten<br />
ADH oder GST Genotypen [4].<br />
Alle Projekte sollen zu einem besseren Verständnis der Ätiologie<br />
der verschiedenen Krankheiten beitragen und Hinweise<br />
auf einen möglichen Mechanismus der Aktivierung<br />
von Karzinogenen durch den menschlichen Stoffwechsel<br />
geben [6]. Anonymisierte Genotypisierungsdaten werden<br />
zur Beantwortung von Fragestellungen, für die sehr viel<br />
größere Fallzahlen notwendig sind, zusätzlich in internatio-<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
181