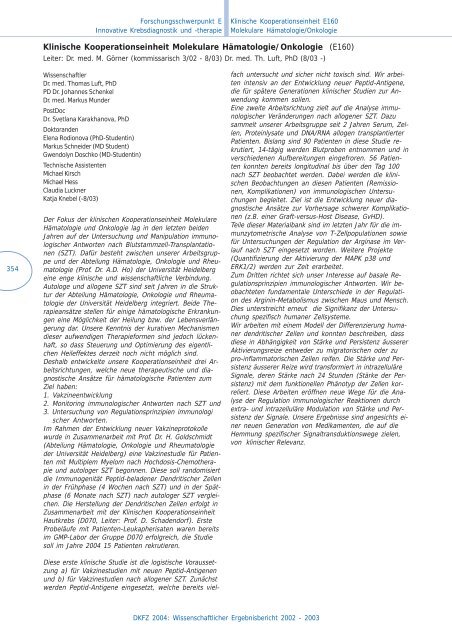MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
354<br />
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
Klinische Kooperationseinheit E160<br />
Molekulare Hämatologie/Onkologie<br />
Klinische Kooperationseinheit Molekulare Hämatologie/Onkologie (E160)<br />
Leiter: Dr. med. M. Görner (kommissarisch 3/02 - 8/03) Dr. med. Th. Luft, PhD (8/03 -)<br />
Wissenschaftler<br />
Dr. med. Thomas Luft, PhD<br />
PD Dr. Johannes Schenkel<br />
Dr. med. Markus Munder<br />
PostDoc<br />
Dr. Svetlana Karakhanova, PhD<br />
Doktoranden<br />
Elena Rodionova (PhD-Studentin)<br />
Markus Schneider (MD Student)<br />
Gwendolyn Doschko (MD-Studentin)<br />
Technische Assistenten<br />
Michael Kirsch<br />
Michael Hess<br />
Claudia Luckner<br />
Katja Knebel (-8/03)<br />
Der Fokus der klinischen Kooperationseinheit Molekulare<br />
Hämatologie und Onkologie lag in den letzten beiden<br />
Jahren auf der Untersuchung und Manipulation immunologischer<br />
Antworten nach Blutstammzell-Transplantationen<br />
(SZT). Dafür besteht zwischen unserer Arbeitsgruppe<br />
und der Abteilung Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie<br />
(Prof. Dr. A.D. Ho) der Universität Heidelberg<br />
eine enge klinische und wissenschaftliche Verbindung.<br />
Autologe und allogene SZT sind seit Jahren in die Struktur<br />
der Abteilung Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie<br />
der Universität Heidelberg integriert. Beide Therapieansätze<br />
stellen für einige hämatologische Erkrankungen<br />
eine Möglichkeit der Heilung bzw. der Lebensverlängerung<br />
dar. Unsere Kenntnis der kurativen Mechanismen<br />
dieser aufwendigen Therapieformen sind jedoch lückenhaft,<br />
so dass Steuerung und Optimierung des eigentlichen<br />
Heileffektes derzeit noch nicht möglich sind.<br />
Deshalb entwickelte unsere Kooperationseinheit drei Arbeitsrichtungen,<br />
welche neue therapeutische und diagnostische<br />
Ansätze für hämatologische Patienten zum<br />
Ziel haben:<br />
1. Vakzineentwicklung<br />
2. Monitoring immunologischer Antworten nach SZT und<br />
3. Untersuchung von Regulationsprinzipien immunologi<br />
scher Antworten.<br />
Im Rahmen der Entwicklung neuer Vakzineprotokolle<br />
wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. H. Goldschmidt<br />
(Abteilung Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie<br />
der Universität Heidelberg) eine Vakzinestudie für Patienten<br />
mit Multiplem Myelom nach Hochdosis-Chemotherapie<br />
und autologer SZT begonnen. Diese soll randomisiert<br />
die Immunogenität Peptid-beladener Dendritischer Zellen<br />
in der Frühphase (4 Wochen nach SZT) und in der Spätphase<br />
(6 Monate nach SZT) nach autologer SZT vergleichen.<br />
Die Herstellung der Dendritischen Zellen erfolgt in<br />
Zusammenarbeit mit der Klinischen Kooperationseinheit<br />
Hautkrebs (D070, Leiter: Prof. D. Schadendorf). Erste<br />
Probeläufe mit Patienten-Leukapherisaten waren bereits<br />
im GMP-Labor der Gruppe D070 erfolgreich, die Studie<br />
soll im Jahre 2004 15 Patienten rekrutieren.<br />
Diese erste klinische Studie ist die logistische Voraussetzung<br />
a) für Vakzinestudien mit neuen Peptid-Antigenen<br />
und b) für Vakzinestudien nach allogener SZT. Zunächst<br />
werden Peptid-Antigene eingesetzt, welche bereits viel-<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
fach untersucht und sicher nicht toxisch sind. Wir arbeiten<br />
intensiv an der Entwicklung neuer Peptid-Antigene,<br />
die für spätere Generationen klinischer Studien zur Anwendung<br />
kommen sollen.<br />
Eine zweite Arbeitsrichtung zielt auf die Analyse immunologischer<br />
Veränderungen nach allogener SZT. Dazu<br />
sammelt unserer Arbeitsgruppe seit 2 Jahren Serum, Zellen,<br />
Proteinlysate und DNA/RNA allogen transplantierter<br />
Patienten. Bislang sind 90 Patienten in diese Studie rekrutiert,<br />
14-tägig werden Blutproben entnommen und in<br />
verschiedenen Aufbereitungen eingefroren. 56 Patienten<br />
konnten bereits longitudinal bis über den Tag 100<br />
nach SZT beobachtet werden. Dabei werden die klinischen<br />
Beobachtungen an diesen Patienten (Remissionen,<br />
Komplikationen) von immunologischen Untersuchungen<br />
begleitet. Ziel ist die Entwicklung neuer diagnostische<br />
Ansätze zur Vorhersage schwerer Komplikationen<br />
(z.B. einer Graft-versus-Host Disease, GvHD).<br />
Teile dieser Materialbank sind im letzten Jahr für die immunzytometrische<br />
Analyse von T-Zellpopulationen sowie<br />
für Untersuchungen der Regulation der Arginase im Verlauf<br />
nach SZT eingesetzt worden. Weitere Projekte<br />
(Quantifizierung der Aktivierung der MAPK p38 und<br />
ERK1/2) werden zur Zeit erarbeitet.<br />
Zum Dritten richtet sich unser Interesse auf basale Regulationsprinzipien<br />
immunologischer Antworten. Wir beobachteten<br />
fundamentale Unterschiede in der Regulation<br />
des Arginin-Metabolismus zwischen Maus und Mensch.<br />
Dies unterstreicht erneut die Signifikanz der Untersuchung<br />
spezifisch humaner Zellsysteme.<br />
Wir arbeiten mit einem Modell der Differenzierung humaner<br />
dendritischer Zellen und konnten beschreiben, dass<br />
diese in Abhängigkeit von Stärke und Persistenz äusserer<br />
Aktivierungsreize entweder zu migratorischen oder zu<br />
pro-inflammatorischen Zellen reifen. Die Stärke und Persistenz<br />
äusserer Reize wird transformiert in intrazelluläre<br />
Signale, deren Stärke nach 24 Stunden (Stärke der Persistenz)<br />
mit dem funktionellen Phänotyp der Zellen korreliert.<br />
Diese Arbeiten eröffnen neue Wege für die Analyse<br />
der Regulation immunologischer Reaktionen durch<br />
extra- und intrazelluläre Modulation von Stärke und Persistenz<br />
der Signale. Unsere Ergebnisse sind angesichts einer<br />
neuen Generation von Medikamenten, die auf die<br />
Hemmung spezifischer Signaltransduktionswege zielen,<br />
von klinischer Relevanz.