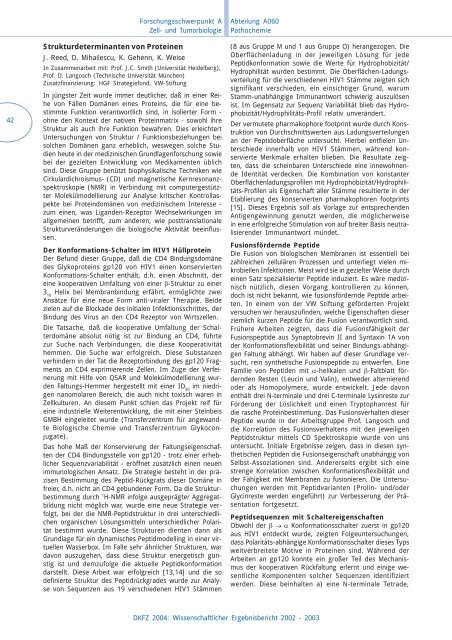MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
42<br />
Forschungsschwerpunkt A<br />
Zell- und Tumorbiologie<br />
Strukturdeterminanten von Proteinen<br />
J. Reed, D. Mihailescu, K. Gehenn, K. Weise<br />
In Zusammenarbeit mit: Prof. J.C. Smith (Universität Heidelberg),<br />
Prof. D. Langosch (Technische Universität München)<br />
Zusatzfinanzierung: HGF Strategiefond, VW-Stiftung<br />
In jüngster Zeit wurde immer deutlicher, daß in einer Reihe<br />
von Fällen Domänen eines Proteins, die für eine bestimmte<br />
Funktion verantwortlich sind, in isolierter Form -<br />
ohne den Kontext der nativen Proteinmatrix - sowohl ihre<br />
Struktur als auch ihre Funktion bewahren. Dies erleichtert<br />
Untersuchungen von Struktur / Funktionsbeziehungen bei<br />
solchen Domänen ganz erheblich, weswegen solche Studien<br />
heute in der medizinischen Grundlagenforschung sowie<br />
bei der gezielten Entwicklung von Medikamenten üblich<br />
sind. Diese Gruppe benützt biophysikalische Techniken wie<br />
Cirkulardichroismus- (CD) und magnetische Kernresonanzspektroskopie<br />
(NMR) in Verbindung mit computergestützter<br />
Molekülmodellierung zur Analyse kritscher Kontrollaspekte<br />
bei Proteindomänen von medizinischem Interesse -<br />
zum einen, was Liganden-Rezeptor Wechselwirkungen im<br />
allgemeinen betrifft, zum anderen, wie posttranslationale<br />
Strukturveränderungen die biologische Aktivität beeinflussen.<br />
Der Konformations-Schalter im HIV1 Hüllprotein<br />
Der Befund dieser Gruppe, daß die CD4 Bindungsdomäne<br />
des Glykoproteins gp120 von HIV1 einen konservierten<br />
Konformations-Schalter enthält, d.h. einen Abschnitt, der<br />
eine kooperativen Umfaltung von einer β-Struktur zu einer<br />
3 Helix bei Membranbindung erfährt, ermöglichte zwei<br />
10<br />
Ansätze für eine neue Form anti-viraler Therapie. Beide<br />
zielen auf die Blockade des initialen Infektionsschrittes, der<br />
Bindung des Virus an den CD4 Rezeptor von Wirtszellen.<br />
Die Tatsache, daß die kooperative Umfaltung der Schalterdomäne<br />
absolut nötig ist zur Bindung an CD4, führte<br />
zur Suche nach Verbindungen, die diese Kooperativität<br />
hemmen. Die Suche war erfolgreich. Diese Substanzen<br />
verhindern in der Tat die Rezeptorbindung des gp120 Fragments<br />
an CD4 exprimierende Zellen. Im Zuge der Verfeinerung<br />
mit Hilfe von QSAR und Molekülmodellierung wurden<br />
Faltungs-Hemmer hergestellt mit einer ID im niedri-<br />
50<br />
gen nanomolaren Bereich, die auch nicht toxisch waren in<br />
Zellkulturen. An diesem Punkt schien das Projekt reif für<br />
eine industrielle Weiterentwicklung, die mit einer Steinbeis<br />
GMBH eingeleitet wurde (Transferzentrum für angewandte<br />
Biologische Chemie und Transferzentrum Glykoconjugate).<br />
Das hohe Maß der Konservierung der Faltungseigenschaften<br />
der CD4 Bindungsstelle von gp120 - trotz einer erheblicher<br />
Sequenzvariabilität - eröffnet zusätzlich einen neuen<br />
immunologischen Ansatz. Die Strategie besteht in der präzisen<br />
Bestimmung des Peptid-Rückgrats dieser Domäne in<br />
freier, d.h. nicht an CD4 gebundener Form. Da die Strukturbestimmung<br />
durch 1H-NMR infolge ausgeprägter Aggregatbildung<br />
nicht möglich war, wurde eine neue Strategie verfolgt,<br />
bei der die NMR-Peptidstruktur in drei unterschiedlichen<br />
organischen Lösungsmitteln unterschiedlicher Polarität<br />
bestimmt wurde. Diese Strukturen dienten dann als<br />
Grundlage für ein dynamisches Peptidmodelling in einer virtuellen<br />
Wasserbox. Im Falle sehr ähnlicher Strukturen, war<br />
davon auszugehen, dass diese Struktur energetisch günstig<br />
ist und demzufolge die aktuelle Peptidkonformation<br />
darstellt. Diese Arbeit war erfolgreich [13,14] und die so<br />
definierte Struktur des Peptidrückgrades wurde zur Analyse<br />
von Sequenzen aus 19 verschiedenen HIV1 Stämmen<br />
Abteilung A060<br />
Pathochemie<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
(8 aus Gruppe M und 1 aus Gruppe O) herangezogen. Die<br />
Oberflächenladung in der jeweiligen Lösung für jede<br />
Peptidkonformation sowie die Werte für Hydrophobizität/<br />
Hydrophilität wurden bestimmt. Die Oberflächen-Ladungsverteilung<br />
für die verschiedenen HIV1 Stämme zeigten sich<br />
signifikant verschieden, ein einsichtiger Grund, warum<br />
Stamm-unabhängige Immunantwort schwierig auszulösen<br />
ist. Im Gegensatz zur Sequenz Variabilität blieb das Hydrophobizität/Hydrophilitäts-Profil<br />
relativ unverändert.<br />
Der vermutete pharmakophore footprint wurde durch Konstruktion<br />
von Durchschnittswerten aus Ladungsverteilungen<br />
an der Peptidoberfläche untersucht. Hierbei entfielen Unterschiede<br />
innerhalb von HIV1 Stämmen, während konservierte<br />
Merkmale erhalten blieben. Die Resultate zeigten,<br />
dass die scheinbaren Unterschiede eine innewohnende<br />
Identität verdecken. Die Kombination von konstanter<br />
Oberflächenladungsprofilen mit Hydrophobizität/Hydrophilitäts-Profilen<br />
als Eigenschaft aller Stämme resultierte in der<br />
Etablierung des konservierten pharmakophoren footprints<br />
[15]. Dieses Ergebnis soll als Vorlage zur entsprechenden<br />
Antigengewinnung genutzt werden, die möglicherweise<br />
in eine erfolgreiche Stimulation von auf breiter Basis neutralisierender<br />
Immunantwort mündet.<br />
Fusionsfördernde Peptide<br />
Die Fusion von biologischen Membranen ist essentiell bei<br />
zahlreichen zellulären Prozessen und unterliegt vielen mikrobiellen<br />
Infektionen. Meist wird sie in gezielter Weise durch<br />
einen Satz spezialisierter Peptide induziert. Es wäre medizinisch<br />
nützlich, diesen Vorgang kontrollieren zu können,<br />
doch ist nicht bekannt, wie fusionsfördernde Peptide arbeiten.<br />
In einem von der VW Stiftung geförderten Projekt<br />
versuchen wir herauszufinden, welche Eigenschaften dieser<br />
ziemlich kurzen Peptide für die Fusion verantwortlich sind.<br />
Frühere Arbeiten zeigten, dass die Fusionsfähigkeit der<br />
Fusionspeptide aus Synaptobrevin II and Syntaxin 1A von<br />
der Konformationsflexibilität und seiner Bindungs-abhängigen<br />
Faltung abhängt. Wir haben auf dieser Grundlage versucht,<br />
rein synthetische Fusionspeptide zu entwerfen. Eine<br />
Familie von Peptiden mit α-helikalen und β-Faltblatt fördernden<br />
Resten (Leucin und Valin), entweder alternierend<br />
oder als Homopolymere, wurde entwickelt. Jede davon<br />
enthält drei N-terminale und drei C-terminale Lysinreste zur<br />
Förderung der Löslichkeit und einen Tryptophanrest für<br />
die rasche Proteinbestimmung. Das Fusionsverhalten dieser<br />
Peptide wurde in der Arbeitsgruppe Prof. Langosch und<br />
die Korrelation des Fusionsverhaltens mit den jeweiligen<br />
Peptidstruktur mittels CD Spektroskopie wurde von uns<br />
untersucht. Initiale Ergebnisse zeigen, dass in diesen synthetischen<br />
Peptiden die Fusionseigenschaft unabhängig von<br />
Selbst-Assoziationen sind. Andererseits ergibt sich eine<br />
strenge Korrelation zwischen Konformationsflexibilität und<br />
der Fähigkeit mit Membranen zu fusionieren. Die Untersuchungen<br />
werden mit Peptidvarianten (Prolin- und/oder<br />
Glycinreste werden eingeführt) zur Verbesserung der Präsentation<br />
fortgesetzt.<br />
Peptidsequenzen mit Schaltereigenschaften<br />
Obwohl der β → α Konformationsschalter zuerst in gp120<br />
aus HIV1 entdeckt wurde, zeigten Folgeuntersuchungen,<br />
dass Polaritäts-abhängige Konformationsschalter dieses Typs<br />
weitverbreitete Motive in Proteinen sind. Während der<br />
Arbeiten an gp120 konnte ein großer Teil des Mechanismus<br />
der kooperativen Rückfaltung erlernt und einige wesentliche<br />
Komponenten solcher Sequenzen identifiziert<br />
werden. Diese beinhalten a) eine N-terminale Tetrade,