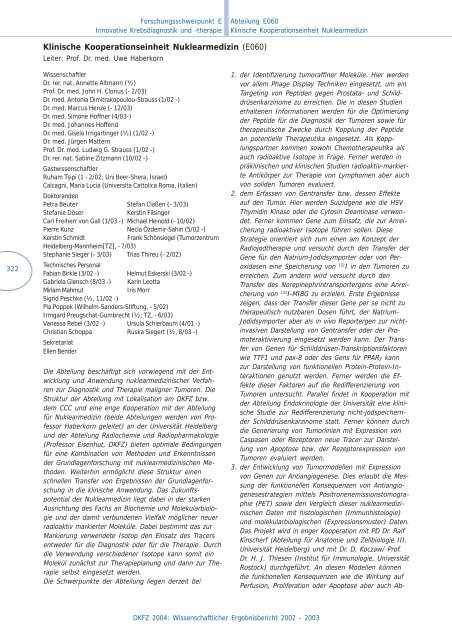MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
MDCK-MRP2 - Dkfz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
322<br />
Forschungsschwerpunkt E<br />
Innovative Krebsdiagnostik und -therapie<br />
Klinische Kooperationseinheit Nuklearmedizin (E060)<br />
Leiter: Prof. Dr. med. Uwe Haberkorn<br />
Wissenschaftler<br />
Dr. rer. nat. Annette Altmann (½)<br />
Prof. Dr. med. John H. Clorius (- 2/03)<br />
Dr. med. Antonia Dimitrakopoulou-Strauss (1/02 -)<br />
Dr. med. Marcus Henze (- 12/03)<br />
Dr. med. Simone Hoffner (4/03-)<br />
Dr. med. Johannes Hoffend<br />
Dr. med. Gisela Irngartinger (½) (1/02 -)<br />
Dr. med. Jürgen Mattern<br />
Prof. Dr. med. Ludwig G. Strauss (1/02 -)<br />
Dr. rer. nat. Sabine Zitzmann (10/02 -)<br />
Gastwissenschaftler<br />
Ruham Tsipi (1 - 2/02; Uni Beer-Shera, Israel)<br />
Calcagni, Maria Lucia (Universita Cattolica Roma, Italien)<br />
Doktoranden<br />
Petra Beuter Stefan Claßen (- 3/03)<br />
Stefanie Döser Kerstin Filsinger<br />
Carl Freiherr von Gall (1/03 -) Michael Heinold (- 10/02)<br />
Pierre Kunz Necla Özdemir-Sahin (5/02 -)<br />
Kerstin Schmidt Frank Schönsiegel (Tumorzentrum<br />
Heidelberg-Mannheim[TZ], - 7/03)<br />
Stephanie Sieger (- 3/03) Trias Thireu (- 2/02)<br />
Technisches Personal<br />
Fabian Birkle (3/02 -) Helmut Eskerski (3/02 -)<br />
Gabriela Glensch (8/03 -) Karin Leotta<br />
Miriam Mahmut Iris Morr<br />
Sigrid Peschke (½, 11/02 -)<br />
Pia Poppek (Wilhelm-Sanders-Stiftung, - 5/02)<br />
Irmgard Preugschat-Gumbrecht (½; TZ, - 6/03)<br />
Vanessa Rebel (3/02 -) Ursula Schierbaum (4/01 -)<br />
Christian Schoppa Ruska Siegert (½, 8/03 -)<br />
Sekretariat<br />
Ellen Bender<br />
Die Abteilung beschäftigt sich vorwiegend mit der Entwicklung<br />
und Anwendung nuklearmedizinischer Verfahren<br />
zur Diagnostik und Therapie maligner Tumoren. Die<br />
Struktur der Abteilung mit Lokalisation am DKFZ bzw.<br />
dem CCC und eine enge Kooperation mit der Abteilung<br />
für Nuklearmedizin (beide Abteilungen werden von Professor<br />
Haberkorn geleitet) an der Universität Heidelberg<br />
und der Abteilung Radiochemie und Radiopharmakologie<br />
(Professor Eisenhut, DKFZ) bieten optimale Bedingungen<br />
für eine Kombination von Methoden und Erkenntnissen<br />
der Grundlagenforschung mit nuklearmedizinischen Methoden.<br />
Weiterhin ermöglicht diese Struktur einen<br />
schnellen Transfer von Ergebnissen der Grundlagenforschung<br />
in die klinische Anwendung. Das Zukunftspotential<br />
der Nuklearmedizin liegt dabei in der starken<br />
Ausrichtung des Fachs an Biochemie und Molekularbiologie<br />
und der damit verbundenen Vielfalt möglicher neuer<br />
radioaktiv markierter Moleküle. Dabei bestimmt das zur<br />
Markierung verwendete Isotop den Einsatz des Tracers<br />
entweder für die Diagnostik oder für die Therapie. Durch<br />
die Verwendung verschiedener Isotope kann somit ein<br />
Molekül zunächst zur Therapieplanung und dann zur Therapie<br />
selbst eingesetzt werden.<br />
Die Schwerpunkte der Abteilung liegen derzeit bei<br />
Abteilung E060<br />
Klinische Kooperationseinheit Nuklearmedizin<br />
DKFZ 2004: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 2002 - 2003<br />
1. der Identifizierung tumoraffiner Moleküle. Hier werden<br />
vor allem Phage Display Techniken eingesetzt, um ein<br />
Targeting von Peptiden gegen Prostata- und Schilddrüsenkarzinome<br />
zu erreichen. Die in diesen Studien<br />
erhaltenen Informationen werden für die Optimierung<br />
der Peptide für die Diagnostik der Tumoren sowie für<br />
therapeutische Zwecke durch Kopplung der Peptide<br />
an potentielle Therapeutika eingesetzt. Als Kopplungspartner<br />
kommen sowohl Chemotherapeutika als<br />
auch radioaktive Isotope in Frage. Ferner werden in<br />
präklinischen und klinischen Studien radioaktiv-markierte<br />
Antikörper zur Therapie von Lymphomen aber auch<br />
von soliden Tumoren evaluiert.<br />
2. dem Erfassen von Gentransfer bzw. dessen Effekte<br />
auf den Tumor. Hier werden Suizidgene wie die HSV<br />
Thymidin Kinase oder die Cytosin Deaminase verwendet.<br />
Ferner kommen Gene zum Einsatz, die zur Anreicherung<br />
radioaktiver Isotope führen sollen. Diese<br />
Strategie orientiert sich zum einen am Konzept der<br />
Radiojodtherapie und versucht durch den Transfer der<br />
Gene für den Natrium-Jodidsymporter oder von Peroxidasen<br />
eine Speicherung von 131 I in den Tumoren zu<br />
erreichen. Zum andern wird versucht durch den<br />
Transfer des Norepinephrintransportergens eine Anreicherung<br />
von 131 I-MIBG zu erzielen. Erste Ergebnisse<br />
zeigen, dass der Transfer dieser Gene per se nicht zu<br />
therapeutisch nutzbaren Dosen führt, der Natrium-<br />
Jodidsymporter aber als in vivo Reportergen zur nichtinvasiven<br />
Darstellung von Gentransfer oder der Promoteraktivierung<br />
eingesetzt werden kann. Der Transfer<br />
von Genen für Schilddrüsen-Transkriptionsfaktoren<br />
wie TTF1 und pax-8 oder des Gens für PPARγ kann<br />
zur Darstellung von funktionellen Protein-Protein-Interaktionen<br />
genutzt werden. Ferner werden die Effekte<br />
dieser Faktoren auf die Redifferenzierung von<br />
Tumoren untersucht. Parallel findet in Kooperation mit<br />
der Abteilung Endokrinologie der Universität eine klinische<br />
Studie zur Redifferenzierung nicht-jodspeichernder<br />
Schilddrüsenkarzinome statt. Ferner können durch<br />
die Generierung von Tumorlinien mit Expression von<br />
Caspasen oder Rezeptoren neue Tracer zur Darstellung<br />
von Apoptose bzw. der Rezeptorexpression von<br />
Tumoren evaluiert werden.<br />
3. der Entwicklung von Tumormodellen mit Expression<br />
von Genen zur Antiangiogenese. Dies erlaubt die Messung<br />
der funktionellen Konsequenzen von Antiangiogenesestrategien<br />
mittels Positronenemissionstomographie<br />
(PET) sowie den Vergleich dieser nuklearmedizinischen<br />
Daten mit histologischen (Immunhistologie)<br />
und molekularbiologischen (Expressionsmuster) Daten.<br />
Das Projekt wird in enger Kooperation mit PD Dr. Ralf<br />
Kinscherf (Abteilung für Anatomie und Zellbiologie III.<br />
Universität Heidelberg) und mit Dr. D. Koczaw/ Prof.<br />
Dr. H. J. Thiesen (Institut für Immunologie, Universität<br />
Rostock) durchgeführt. An diesen Modellen können<br />
die funktionellen Konsequenzen wie die Wirkung auf<br />
Perfusion, Proliferation oder Apoptose aber auch Ab-