- Seite 1:
Bericht der Bundesregierung zur Sit
- Seite 4 und 5:
Stellungnahme der Bundesregierung 1
- Seite 6 und 7:
FDP ein „Bericht zur Lage der Fra
- Seite 8 und 9:
nehmen und ihnen Information und Un
- Seite 10 und 11:
Thema Zwangsverheiratung beraten ha
- Seite 12 und 13:
Behinderungen in Deutschland“ wir
- Seite 14 und 15:
Informationen aller Gleichstellungs
- Seite 16 und 17:
Der Mehrwert der Bestandsaufnahme g
- Seite 18 und 19:
ichtungen insbesondere in dünn bes
- Seite 20 und 21:
keine Rückschlüsse darauf gezogen
- Seite 22 und 23:
den diejenigen Fachberatungsstellen
- Seite 24 und 25:
ken. Der mosaikartige Charakter der
- Seite 26 und 27:
Aus Sicht der Bundesregierung sind
- Seite 28 und 29:
von Hilfe und Unterstützung für g
- Seite 30 und 31:
die Finanzierung von Einrichtungen
- Seite 32 und 33:
3.4 Bundesweites Hilfetelefon bei G
- Seite 34 und 35:
Es geht dabei nicht um Leistungsans
- Seite 36 und 37:
3.9 Neue Impulse für Versorgungsko
- Seite 38 und 39:
Vorwort Hiermit legt das Sozialwiss
- Seite 40 und 41:
Teil 1 Sozialwissenschaftliche Ist-
- Seite 42 und 43:
D Beratungszugang nach Gewalt - Ein
- Seite 44 und 45:
Ausmaßen) als Privatangelegenheit,
- Seite 46 und 47:
Verantwortung für das Hilfesystem
- Seite 48 und 49:
A3 Vorhandene Daten und Analysen de
- Seite 50 und 51:
Gleichstellungsbeauftragten kann ni
- Seite 52 und 53:
• 40 Fachberatungsstellen spezial
- Seite 54 und 55:
Datenqualität Die vorliegenden Dat
- Seite 56 und 57:
individuellen Bedarf zu decken. Wel
- Seite 58 und 59:
chen und Frauen, die von Zwangsverh
- Seite 60 und 61:
Abbildung 5: Versorgungsdichte mit
- Seite 62 und 63:
Am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns
- Seite 64 und 65:
B2.3 Gewaltbetroffenheitsquote der
- Seite 66 und 67:
Abbildung 10: Lebenszeitprävalenz
- Seite 68 und 69:
kann dies dazu reichen, eine Quote
- Seite 70 und 71:
• Die Auslastung kann Hinweise au
- Seite 72 und 73:
Hälfte der befragten Frauenhäuser
- Seite 74 und 75:
eiterinnen abgedeckt (vgl. Tabelle
- Seite 76 und 77:
Abbildung 15: Eigenmittel der Fraue
- Seite 78 und 79:
Abbildung 16: Lösung für Probleme
- Seite 80 und 81:
Wenn Frauen in ein Frauenhaus komme
- Seite 82 und 83:
Abbildung 19: Eignung der Frauenhä
- Seite 84 und 85:
Abbildung 21: Finanzierung für Dol
- Seite 86 und 87:
Abbildung 23: Rollstuhlgerechte Aus
- Seite 88 und 89:
Abbildung 25: Eignung der Frauenhä
- Seite 90 und 91:
Abbildung 27: Nicht aufgenommene /
- Seite 92 und 93:
Abbildung 29: Auslastungsquoten in
- Seite 94 und 95:
ankert seien (79%). Dieser Widerspr
- Seite 96 und 97:
Abbildung 33: Eigenständige Unters
- Seite 98 und 99:
che Gelder für die Unterstützung
- Seite 100 und 101:
Abbildung 36: Häufigkeit verbindli
- Seite 102 und 103:
den. Damit werden zwei Gruppen von
- Seite 104 und 105:
zeilicher Intervention anbieten. Fa
- Seite 106 und 107:
Abbildung 40: Anzahl der Klientinne
- Seite 108 und 109:
Einige Fachberatungsstellen - z.B.
- Seite 110 und 111:
Abbildung 44: Ressourcen für Kinde
- Seite 112 und 113:
• Qualifikationen Das Spektrum an
- Seite 114 und 115:
Abbildung 49: Volumen an ehrenamtli
- Seite 116 und 117:
stellen bei Menschenhandel bedeutet
- Seite 118 und 119:
Für die Fachberatungsstellen gilt
- Seite 120 und 121:
zwei Opferberaterinnen und seit 200
- Seite 122 und 123:
hungsberatungsstellen (mit untersch
- Seite 124 und 125:
Der Blick auf die Familienberatungs
- Seite 126 und 127:
linder Frauen und auch auf andere B
- Seite 128 und 129:
oft Paarberatung angeboten. Damit e
- Seite 130 und 131:
len Spezialisierung auf Täterarbei
- Seite 132 und 133:
Abbildung 59: In der Region ausreic
- Seite 134 und 135:
Abbildung 60: Einwohnerzahl der Kom
- Seite 136 und 137:
„Es fehlt hier alles, es gibt kei
- Seite 138 und 139:
Abbildung 62: Zusätzliche Unterst
- Seite 140 und 141:
B4 Umsetzung und Nutzung von rechtl
- Seite 142 und 143:
Tabelle 6: Definitionen häuslicher
- Seite 144 und 145:
Sachsen Definition häusliche Gewal
- Seite 146 und 147:
Eine Auswertung der PKS-Daten aus d
- Seite 148 und 149:
Tabelle 8: Polizeiliche Interventio
- Seite 150 und 151:
hohen Sicherheitsbedarf haben und f
- Seite 152 und 153:
Die Anzahl der Verfahren nach dem G
- Seite 154 und 155:
C Bundeslandprofile Zum Auftrag geh
- Seite 156 und 157:
Bundesland 31.12.2003 Veränderung
- Seite 158 und 159:
Für eine Planung von Schutzangebot
- Seite 160 und 161:
Baden-Württemberg Strukturdaten (Q
- Seite 162 und 163:
Kommunale Ko-Finanzierung als Vorau
- Seite 164 und 165:
Angebote für von Gewalt betroffene
- Seite 166 und 167:
Berlin Strukturdaten Bevölkerungsz
- Seite 168 und 169:
Rechtliche Grundlage für Förderun
- Seite 170 und 171:
Brandenburg Strukturdaten Bevölker
- Seite 172 und 173: Unterschiede bei der Zuwendung, z.B
- Seite 174 und 175: Angaben der Landesregierung: Politi
- Seite 176 und 177: Hamburg Strukturdaten Bevölkerungs
- Seite 178 und 179: Gesamtumfang der Förderung Rechtli
- Seite 180 und 181: Weitere nicht auf Gewalt spezialisi
- Seite 182 und 183: Rahmenbedingungen Landesprävention
- Seite 184 und 185: Angaben der Landesregierung: Politi
- Seite 186 und 187: Niedersachsen Strukturdaten (Quelle
- Seite 188 und 189: Fachberatungsstellen für Lesben un
- Seite 190 und 191: Nordrhein-Westfalen Strukturdaten (
- Seite 192 und 193: Rechtliche Grundlage für Förderun
- Seite 194 und 195: - Frauen mit Behinderungen 1 Angebo
- Seite 196 und 197: Saarland Strukturdaten Bevölkerung
- Seite 198 und 199: weitere Angebote / Besonderheiten d
- Seite 200 und 201: - sexuelle Gewalt (Frauen) 4 - sexu
- Seite 202 und 203: Sachsen-Anhalt Strukturdaten (Quell
- Seite 204 und 205: Kommunale Ko-Finanzierung als Vorau
- Seite 206 und 207: Schleswig-Holstein Strukturdaten (Q
- Seite 208 und 209: Gesamtumfang der Landesförderung K
- Seite 210 und 211: Thüringen Strukturdaten Bevölkeru
- Seite 212 und 213: Qualitative Vorgaben für die Förd
- Seite 214 und 215: • sind seltener Verwaltungskräft
- Seite 216 und 217: Weitervermittlung Bei den Weiterver
- Seite 218 und 219: Die Mehrheit (12) der aufgenommenen
- Seite 220 und 221: • Profil Frauenhaus im ländliche
- Seite 224 und 225: Es wurden Fragen zu empfohlenen Ans
- Seite 226 und 227: von therapeutischem Rat (siehe Abbi
- Seite 228 und 229: D3.1 Präferierte Quellen und Suchs
- Seite 230 und 231: D3.3 Profil der Informationsquellen
- Seite 232 und 233: Q12 Wie lange liegt das zurück? w
- Seite 234 und 235: 50.000 Einwohnern und Einwohnerinne
- Seite 236 und 237: Abbildung 78: Bedarfsdeckung nach H
- Seite 238 und 239: Nur wenige nannten andere Gründe o
- Seite 240 und 241: tung leistet und wo und wie sie hil
- Seite 242 und 243: E Zusammenfassung der wichtigsten E
- Seite 244 und 245: sourcen (vgl. B3.2.3). Hierfür kö
- Seite 246 und 247: teristische Struktur von Interventi
- Seite 248 und 249: nationaler Ebene“ Bezug genommen
- Seite 250 und 251: • zu jeder Tageszeit neue Bewohne
- Seite 252 und 253: tisch für dieses Arbeitsfeld. Dies
- Seite 254 und 255: gende Anzahl der Verfahren nach Anz
- Seite 256 und 257: • Zuschneiden von niedrigschwelli
- Seite 258 und 259: F Literatur BMFSFJ (Hg.) (1999) Ber
- Seite 260 und 261: Teil II Probleme des geltenden Rech
- Seite 262 und 263: ) Kosten infolge fremdsprachlicher
- Seite 264 und 265: Teil 1: Gutachtenauftrag und Gutach
- Seite 266 und 267: Rechtsnormen werden hierbei konsequ
- Seite 268 und 269: II. Zur Methode des Gutachtens, ins
- Seite 270 und 271: Teil 2: Problemanalyse des geltende
- Seite 272 und 273:
Auf der Grundlage des hier zugrunde
- Seite 274 und 275:
) Finanzierungsarten als Weichenste
- Seite 276 und 277:
Da in der Praxis - nicht zuletzt an
- Seite 278 und 279:
lich und örtlich zuständigen Trä
- Seite 280 und 281:
Gewalt nach dem SGB II, einem ander
- Seite 282 und 283:
dem auch der gewalttätige (Ehe-)Ma
- Seite 284 und 285:
zw. Bedrohungslage entfliehen musst
- Seite 286 und 287:
Zu beachten ist, dass Dritten unter
- Seite 288 und 289:
(b) Die Heranziehung des unterhalts
- Seite 290 und 291:
weit ersichtlich, bei der Anwendung
- Seite 292 und 293:
Zurückhaltender kann es auch heiß
- Seite 294 und 295:
eschafft und die entsprechende Summ
- Seite 296 und 297:
ezogen auf eine einzelne Frau konkr
- Seite 298 und 299:
fähig“), was die ihr aufgezwunge
- Seite 300 und 301:
Die Unzumutbarkeit kann sich auch a
- Seite 302 und 303:
Abgrenzungen sehr unscharf. 247 Das
- Seite 304 und 305:
organisiert. Die zuständigen Sozia
- Seite 306 und 307:
setzt voraus, dass die Frauenhäuse
- Seite 308 und 309:
selbst bestimmt werden. 276 Damit w
- Seite 310 und 311:
len (§ 42 SGB I), wobei das insowe
- Seite 312 und 313:
(§ 18d S. 2 SGB II). Dies lässt s
- Seite 314 und 315:
(2) Kein Selbstkostendeckungsprinzi
- Seite 316 und 317:
Finanzierungselement) basiert deren
- Seite 318 und 319:
Die Zuwendungsfinanzierung insbeson
- Seite 320 und 321:
zwar geändert werden, es ist aber
- Seite 322 und 323:
3. Reformoption: Bedarfsplanung dur
- Seite 324 und 325:
Gründen einer staatlichen Stelle o
- Seite 326 und 327:
4. Kostenerstattung a) Problem Gem
- Seite 328 und 329:
IV. Zur Lage von Fachberatungsstell
- Seite 330 und 331:
Teil 3: Verfassungsrechtlicher Gest
- Seite 332 und 333:
spruch auf Hilfe und Unterstützung
- Seite 334 und 335:
niert wird, lässt sich nicht in ei
- Seite 336 und 337:
2. Art. 72 Abs. 2 GG a) Die Vorgabe
- Seite 338 und 339:
gemeinschaft“ 451 dienen. Das Bun
- Seite 340 und 341:
heiten“ 471 gewichtige Tatsachen,
- Seite 342 und 343:
dass daraus der Schluss gezogen wer
- Seite 344 und 345:
S. 7 GG, sondern zum Aufgabenbegrif
- Seite 346 und 347:
Nicht unter dem Begriff der „Geld
- Seite 348 und 349:
„Nullsummenspiel“ führen, das
- Seite 350 und 351:
Teil 4: Zusammenfassung der wesentl
- Seite 352 und 353:
(4) Hindernisse beim effektiven Zug
- Seite 354 und 355:
(8) Zugangshindernisse im Finanzier
- Seite 356 und 357:
321
- Seite 358 und 359:
1. Beachtliche Erfolge bei der Unte
- Seite 360 und 361:
zen. 557 Frauenhäuser und Fachbera
- Seite 362 und 363:
eachten, die insbesondere auch der
- Seite 364 und 365:
1 Anhang zum sozialwissenschaftlich
- Seite 366 und 367:
• Muster von psychischer, körper
- Seite 368 und 369:
Sexuelle Gewalt seit 16. Lebensjahr
- Seite 370 und 371:
Körperliche und/oder sexuelle Gewa
- Seite 372 und 373:
Muster von psychischer, körperlich
- Seite 374 und 375:
Sexuelle Gewalt seit 16. Lebensjahr
- Seite 376 und 377:
Quelle: Schröttle/Müller 2004: Pr
- Seite 378 und 379:
Körperliche und/oder sexuelle Gewa
- Seite 380 und 381:
Tabelle 21: Hauptsächliches Einzug
- Seite 382 und 383:
Tabelle 26: Zahl der verbindlich mi
- Seite 384 und 385:
Insgesamt (n=199) 22 055 13 497 Que
- Seite 386 und 387:
Rheinland-Pfalz (n=11) 484 5 91 Saa
- Seite 388 und 389:
Andere Gruppen 15 Quelle: Bestandsa
- Seite 390 und 391:
Tabelle 47: Polizeiliche Aus- und F
- Seite 392 und 393:
Länder Themenkomplexe Kenntnisse /
- Seite 394 und 395:
Länder Themenkomplexe Kenntnisse /
- Seite 396 und 397:
Länder Themenkomplexe Häusliche G
- Seite 398 und 399:
Länder Themenkomplexe Kenntnisse /
- Seite 400 und 401:
2 Anhang rechtswissenschaftliches G
- Seite 402 und 403:
Beispiel Jobcenter Koblenz: 576 „
- Seite 404 und 405:
Beispiel Landkreis Börde: 585 „B
- Seite 406 und 407:
Beispiel Bielefeld: 592 „Ausnahme
- Seite 408 und 409:
Beispiel Kreis Düren: 598 „Sucht
- Seite 410 und 411:
Beispiel Märkischer Kreis: 604 „
- Seite 412 und 413:
„Wird ein Antrag durch eine Perso
- Seite 414 und 415:
ge Leistungs-, Vergütungs- und Pr
- Seite 416 und 417:
§ 6 Ausschluss der Förderung Eine
- Seite 418 und 419:
Richtlinien zur Förderung von Frau
- Seite 420 und 421:
4. Andere Zuwendungsempfänger 4.1
- Seite 422 und 423:
III. Die Arbeiterwohlfahrt Landesve
- Seite 424 und 425:
Die Beratungs- und Betreuungsarbeit
- Seite 426 und 427:
Falls von den Qualitätsmerkmalen a
- Seite 428 und 429:
Das Ergebnis der Prüfung durch das
- Seite 430 und 431:
Der Stadtverband Saarbrücken und d
- Seite 432 und 433:
1.2 Zweck der Förderung ist es, du
- Seite 434 und 435:
Stufe Anzahl der Frauenplätze Mult
- Seite 436 und 437:
8.2 Die Bewilligungsbehörde prüft
- Seite 438 und 439:
sonderer Vereinbarung (vgl. Nr. 6.1
- Seite 440 und 441:
- Kosten des angemessenen Fachperso
- Seite 442 und 443:
2.6 Rahmenvereinbarung (Anlage 4 de
- Seite 444 und 445:
Berücksichtigung aller Umstände u
- Seite 446 und 447:
Abbildung 19: Eignung der Frauenhä
- Seite 448 und 449:
Abbildung 56: Spezifisch qualifizie
- Seite 450 und 451:
Tabelle 17: Anhang: Stichprobenbesc




![K.O.-Tropfen Faltblatt [ PDF ]](https://img.yumpu.com/21026951/1/190x135/ko-tropfen-faltblatt-pdf-.jpg?quality=85)
![Eine Stellungnahme zu einem irreführenden Begriff [PDF-Download]](https://img.yumpu.com/20979304/1/184x260/eine-stellungnahme-zu-einem-irrefuhrenden-begriff-pdf-download.jpg?quality=85)
![Anmeldeformular [PDF-Download]](https://img.yumpu.com/20932944/1/190x135/anmeldeformular-pdf-download.jpg?quality=85)
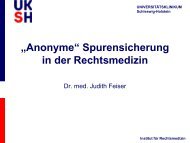
![27.05.09 K.O.-Tropfen Aufklärungskampagne [ PDF ]](https://img.yumpu.com/20902134/1/184x260/270509-ko-tropfen-aufklarungskampagne-pdf-.jpg?quality=85)


![Landesverband Frauenberatung Schleswig Holstein - LFSH [PDF]](https://img.yumpu.com/20876747/1/190x128/landesverband-frauenberatung-schleswig-holstein-lfsh-pdf.jpg?quality=85)
