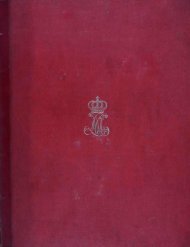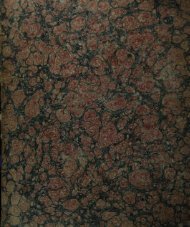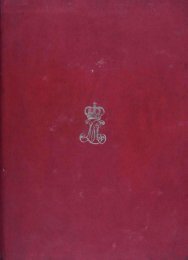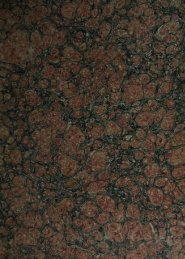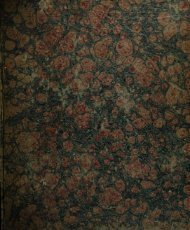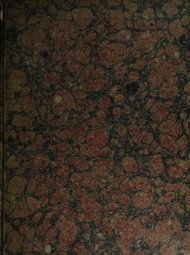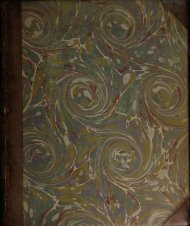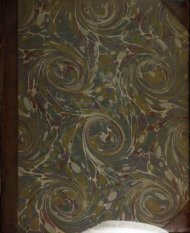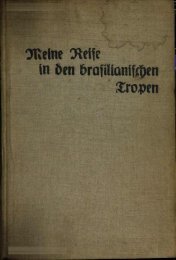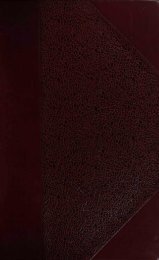- Seite 1:
• M B
- Seite 4:
$r« Grtrl t»0tt Hett cícittcn rn
- Seite 7:
Unter den Katurvólkern Zentraí-Br
- Seite 10 und 11:
Das Reoht der Uebersetzung in fremd
- Seite 12 und 13:
arktischen Kollegen und des Geograp
- Seite 14 und 15:
Inhalts-Verzeichnis. I. Kapitel. Re
- Seite 16 und 17:
X — am Schingú. Ursprung des Hol
- Seite 18 und 19:
Verzeichnis der Text Abbildungen. A
- Seite 20 und 21:
— XIV — AbbUdung 93. Netzgeflec
- Seite 23 und 24:
I. KAPITEL. Reise nach Cuyabá und
- Seite 25 und 26:
— 3 - in ( u) aba gewesen, rt.itU
- Seite 27 und 28:
~ 5 — St. Catharina Lebewohl. Die
- Seite 29 und 30:
— 7 — eine Strecke von 2300 Kil
- Seite 31 und 32:
— 9 — l.in ganz bcsonders drast
- Seite 33 und 34:
II — 34 I.eute mit 40 Red- oder L
- Seite 35 und 36:
— 13 — Auf dem ersten Lagerplat
- Seite 37 und 38:
3 komptiiMite Ankcruhren. Zu erdmag
- Seite 39:
LU rr rr X TAF 2 3 o tr OD O -1 (E
- Seite 42 und 43:
— i8 — nach dem am folgenden Ta
- Seite 44 und 45:
20 — bilden in der Thalmulde jene
- Seite 46 und 47:
Lãhmung der hintern Extremitàten
- Seite 48 und 49:
hatte sie vergeblich verfolgt. Jetz
- Seite 50 und 51:
III. KAPITEL. Von Cuyabá zum Indep
- Seite 52 und 53:
— 28 — und drei Messingknõpfen
- Seite 54 und 55:
— 3o — schwàcher oder man hõr
- Seite 56 und 57:
— 32 — azurblauen, in den Sonne
- Seite 59 und 60:
— 33 — Die Bruacas und Gep,,( k
- Seite 61 und 62:
— 35 — zu Lcidc gethan hat, war
- Seite 63 und 64:
- 37 — und vcrscngtcn Kopf zur Se
- Seite 65 und 66:
— 39 — Wilhelm auf den Fingem,
- Seite 67 und 68:
— 4i - goldfuhrendem Sand, a «se
- Seite 69 und 70:
— 43 — grauschwarzem, trocknem
- Seite 71 und 72:
— 45 — Was endlich den Untorhal
- Seite 73 und 74:
— 47 — Ochsenfell vertatischt w
- Seite 75:
d. Sitinen, Zcntral - Rrasilien. TA
- Seite 78 und 79:
— jo — Schwingungon wiegend. Ge
- Seite 80 und 81:
Wir ruderten zwei Stunden kráftig
- Seite 82 und 83:
— 54 Durcheinanderrufen, und eini
- Seite 84 und 85:
— 56 - damals bei Koblenz vor uns
- Seite 86 und 87:
zeichnungen erfinden; es gab, wie i
- Seite 88 und 89:
— 6o — Zuweilen kam auch eins d
- Seite 90 und 91:
— 62 - Das Haus Tumayaua's war ei
- Seite 92 und 93:
- 64 - oder Baumwollbinden um den O
- Seite 95 und 96:
^5 wie citle Kinder. Luchu war glü
- Seite 97 und 98:
- 67 - am Araguay etwas Aehnliche-
- Seite 99 und 100:
- 69 - man rauchte Zigarren oder ri
- Seite 101 und 102:
— 7i ~ Einzelne Indianer-tammc wu
- Seite 103:
Swincn. Zvivtral- lírasilicn. 00 T
- Seite 106 und 107:
— 74 - waren, in gebückter Haltu
- Seite 108 und 109:
- 76 - besondern Grund, weil sie «
- Seite 110 und 111:
- 78 - emeritierter Gymnasialdirekt
- Seite 112 und 113:
— 8o — so waren dabei doch grob
- Seite 114 und 115:
VI. KAPITEL. I. Gemeinsamer Aufbruc
- Seite 116 und 117:
- 84 - eiligst hinzu und fand ihn v
- Seite 118 und 119:
— 86 — zu beobachten, wie eine
- Seite 120 und 121:
— 88 Fluss versperrt und quer dur
- Seite 122 und 123:
— 9o — Spáter am Abend beganne
- Seite 124 und 125:
— 92 — auf die Reise mitgenomme
- Seite 126 und 127:
— 94 — anerkennungswertem Gedá
- Seite 128 und 129:
- 96 - Pause an einem fischreichen
- Seite 131 und 132:
— 97 — in den Kürbisschalen wa
- Seite 133 und 134:
Ausser mehreren Frauen lebten unter
- Seite 135 und 136:
— IOI — Unter der Beute heimkeh
- Seite 137 und 138:
— 103 — dort mit ka a a . . . e
- Seite 139:
v. d. Steinen, /entrai - r.r.isilie
- Seite 142 und 143:
— io6 — der Rückfahrt besuchte
- Seite 144 und 145:
— 108 — feierlichem Schweigen.
- Seite 146 und 147:
— I IO — Dort befanden sich an
- Seite 148 und 149:
— 112 — Baumwurzeln aufsass. Di
- Seite 151 und 152:
— ii3 — bekommcn. Das wenigc Ma
- Seite 153 und 154:
— H5 — mir. Das milham hcrbeige
- Seite 156 und 157:
— i iS — ein Stamm der A ruma o
- Seite 158 und 159:
— 120 Auf dem Platz fanden sich e
- Seite 161 und 162:
— 121 — MI hl bcstand, bei jene
- Seite 163 und 164:
— 123 — Es waren mci-t kleine s
- Seite 165 und 166:
— 125 — flachlichen Nachgrabcn
- Seite 167 und 168:
— 127 — Nahuquá vom Kuluene, w
- Seite 169:
ti. Slcincn, /entrai-llravilicn. TA
- Seite 172 und 173:
— 13^ — überrascht, machten wi
- Seite 174 und 175:
132 — und zweiseitigem Dach begon
- Seite 176 und 177:
— 134 — dessen Rinde ein Kanu g
- Seite 178 und 179:
no form oder Sublimat getotet und k
- Seite 181 und 182:
'37 — verübtc kleine Diebcreicn.
- Seite 183 und 184:
- E39 — unvcrantwortlich aufs Spi
- Seite 185 und 186:
— 141 — Verdauungsstõrungen wa
- Seite 187 und 188:
— 143 — Am 4. Dezember cntdcckt
- Seite 189 und 190:
— i.U Bambusquerholzern, der Pang
- Seite 191 und 192:
— 147 ~ intcres-ante Art veiimgli
- Seite 193 und 194:
— IV) hatten wir viele Muhe, die
- Seite 195 und 196:
— i5i wohnte der Begleiter Rondon
- Seite 197 und 198:
VIII. KAPITKL. I. Geographie und Kl
- Seite 199 und 200:
— '55 — zahl Manitsaua in Gefan
- Seite 201 und 202:
157 — Die Tapuya sind die ostbras
- Seite 203 und 204:
— 159 — Wie die Xahuqua neun ve
- Seite 205:
v. d. Si,i,,on. Zciural-lln-ilien.
- Seite 208 und 209:
IÔ2 Mitteln der Serien zurücktrit
- Seite 210 und 211:
Laiigenbreiten-Index des Kopfes. Wa
- Seite 212 und 213:
— i66 — genbeinhi M Trumaí Bak
- Seite 214 und 215:
— i68 — Mánner Max. Min. Mitt.
- Seite 216 und 217:
— 170 — vielleicht eine der bei
- Seite 218 und 219:
— 172 — zeigt uns den besten Ve
- Seite 220 und 221:
— 174 — sich zweckbewusst zunà
- Seite 222 und 223:
— 176 — Alies übrige Kõrperha
- Seite 225 und 226:
— 177 — Uebrigen wurde die Bart
- Seite 227 und 228:
— 179 — waren, sich aber gut ko
- Seite 229 und 230:
— 181 — anlchnt, die mit den we
- Seite 231 und 232:
- i83 - dass sie auf der Schnur ein
- Seite 233 und 234:
- i85 - giebt. Die eine, an die wir
- Seite 235 und 236:
- i87 - -ichten dos Schmucks umgest
- Seite 237 und 238:
— i8o Kun-t gar nicht bcfassten.
- Seite 239 und 240:
— 191 — den Eintritt der Mannba
- Seite 241 und 242:
— i93 — untere enge Ende des Tr
- Seite 243 und 244:
— 195 — haut ist der allen Vorr
- Seite 245 und 246:
107 — Frau die Muco-.i zugánglic
- Seite 247 und 248:
machen, er wird damit in die Reihe
- Seite 249 und 250:
— 201 — wciden sollte, zu grõs
- Seite 251 und 252:
203 — bei unsern prachistorischen
- Seite 253 und 254:
?o; — Yor-tellung von den Mensche
- Seite 255 und 256:
— 207 — gebracht. Saugctierknoc
- Seite 257 und 258:
— 20Q und Bogen, -ic fischten mit
- Seite 259 und 260:
2 11 — Wort ^pa/.nba", das die Li
- Seite 261 und 262:
— 213 — In giaben werden. l)er
- Seite 263 und 264:
2 i; Jagertmn. Die Ti.iu des Boror
- Seite 265 und 266:
217 — Wie die Kürbisse zum Trink
- Seite 267 und 268:
2I9 zu ZIK ht( n. Ja, die Stellung,
- Seite 269 und 270:
221 gut bckannt und das Marchen von
- Seite 271 und 272:
gnng, die die Hauptsache ist, ein z
- Seite 273 und 274:
Bei -tarkem Widei land des Objekte-
- Seite 275 und 276:
1 1 - - - / Ze.t der Uebertiagung l
- Seite 277 und 278:
— 229 — Bogen und Pfeile sind a
- Seite 279 und 280:
23» — Anblick! Bt-im Fi-ehscliie
- Seite 281 und 282:
— -33 — vorgo-olieno Mogli, hke
- Seite 283 und 284:
esonders an dem eingc-tulpten Hintc
- Seite 285 und 286:
mit anderen Stàbi hcn bedeckt, sod
- Seite 287 und 288:
2Y) den beiden er-tercn Arten einge
- Seite 289:
d, Suincn, Zentral-Hr.ivilien. TAFE
- Seite 292 und 293:
242 Wõlbung sie beibehalten haben,
- Seite 294 und 295:
— 244 — verstárkt. Wir sehen,
- Seite 296 und 297:
— 246 — Aufsatz über Das Zeich
- Seite 298 und 299:
Abb. 34. Malrincham - Sandzeichnuns
- Seite 301:
Bakairí. Karlv.d.St. Mutze. darunl
- Seite 305: Jndianerin. Pfeife. ^V & Schildkró
- Seite 308 und 309: - 2$Q - kõnnen am Kopf, am Hals un
- Seite 310 und 311: — 252 — trennt, bleibt der Kinn
- Seite 312 und 313: 254 Kulisehu-Tafel II bei dem Nahuq
- Seite 314 und 315: Abb. 37. Rindenfigur der Bakairí.
- Seite 317: L d. Steinen. Zentral-Brasilien. ll
- Seite 320 und 321: — 258 — der Mchinakú bei, wo d
- Seite 322 und 323: 2ÓO — figur, in Nr. 15 der Flãc
- Seite 324 und 325: Ô2 — lang), Xahuqua irínko, Meh
- Seite 326 und 327: — 264 — einzelnen Fische aneina
- Seite 329 und 330: — 26: begnugten. Und seltsamer We
- Seite 331 und 332: - 26; - Nr. 5 j,i da> echte, recht
- Seite 333 und 334: - 26
- Seite 335 und 336: — 271 Ich will kurz die am mci-te
- Seite 337 und 338: — 2/3 — Kamayurá, Abb. 50, den
- Seite 339 und 340: •1-3 Erklárung empfiehlt, da s h
- Seite 341 und 342: •// schon vorkommt, sondem dreifa
- Seite 343 und 344: 2/9 dic-c I hure ais ob er -agen wo
- Seite 345 und 346: 28l — •mebt Vierfu-sler mit lan
- Seite 347 und 348: *3 - Von dieser Elephantiasis abge-
- Seite 349 und 350: — 285 — Spit/en-tin k auf freie
- Seite 351 und 352: - 2-S7 - StiK k gearbeitet. 42 cm l
- Seite 353: .pKraati.Brràn ..isihen Tbpfe vom
- Seite 358 und 359: — 290 — ihrem Realismus durch d
- Seite 360 und 361: 292 — gebuchtet. Der Kopf des Erp
- Seite 362 und 363: -- 294 — ist, noch wáhlt sie die
- Seite 364 und 365: — 296 — I. Masken. Auf der zwei
- Seite 366 und 367: — 298 — Jeder Stamm kannte die
- Seite 368 und 369: — 300 — in den Sitzungen, versc
- Seite 370 und 371: 302 verschnürender Schlitz. Falls
- Seite 372 und 373: 304 —
- Seite 374 und 375: 306 koálu heisst, vorhanden ist. J
- Seite 376 und 377: 3 o8 Wir suchten uns die acht schó
- Seite 378: IO wenn man die geílochtenen Kapiv
- Seite 381 und 382: — 3'3 — Ausser den Wachsmasken
- Seite 383 und 384: — 3'5 — Alie Holzmasken (vgl. d
- Seite 385 und 386: 3>: gcmalten Mereschu-Muster und oh
- Seite 387 und 388: — 3'9 — Bei drei Masken findet
- Seite 389 und 390: — 321 — Wenn man -nli jedoch cr
- Seite 391 und 392: — 323 — Dcnnoch darf nicht verg
- Seite 393 und 394: 325 eckigcn Aufsatz so eingeflochte
- Seite 395 und 396: 327 Flõten (bis 8o cm lang) au> Ba
- Seite 397 und 398: — 329 - Billigerc Diademe wurden
- Seite 399 und 400: — 33i — sodass Felipe an eine S
- Seite 401 und 402: — 333 — von Iremden, nicht zum
- Seite 403 und 404: — 335 -- ttibe eingerichtet, inde
- Seite 405 und 406: 337 Von der mcnschlichcn Eizclle un
- Seite 407 und 408:
die klarc Yor-tcllung eines «Teils
- Seite 409 und 410:
— u> Wie entsteht nun eine solche
- Seite 411 und 412:
— .UÍ — Die Medizinmánner wer
- Seite 413 und 414:
-- 345 einen starken Erregungszusta
- Seite 415 und 416:
— 347 — Zauberarzte. Ihr eigent
- Seite 417 und 418:
— 349 — Ein /.weiter nicht unwe
- Seite 419 und 420:
... 35i - Dass man jcdoch alie ^ung
- Seite 421 und 422:
— 3
- Seite 423 und 424:
— 355 — oder tla-s der Kampfuch
- Seite 425 und 426:
- 357 - In einem am Amazona- -ehr v
- Seite 427 und 428:
— 359 Nachts bedecken lassen, noc
- Seite 429 und 430:
56-1 - gangt ii. Es -ind nur Figure
- Seite 431 und 432:
3geht ein wenig beiseite und findet
- Seite 433 und 434:
- 3^5 - Wõrter*). Ein Ztifall ist
- Seite 435 und 436:
36/ bis zum Kulisehu nach O-ten vor
- Seite 437 und 438:
— 369 — eine Geschichte, zu der
- Seite 439 und 440:
.V Was die Mutter selb-t betrifft,
- Seite 441 und 442:
— 37^5 - nur wenige*. Ebenso gab
- Seite 443 und 444:
— 375 - September, wenn der Regen
- Seite 445 und 446:
- V7 — Feuer. Keri und Kame ginge
- Seite 447 und 448:
— 379 — Beijús vor. Sie gaben
- Seite 449 und 450:
- 381 - kommen dann jedoch andere L
- Seite 451 und 452:
- 3«3 ^ Der hilssliche Strauss. De
- Seite 453 und 454:
- 385 - Da pisste er, trank seinen
- Seite 455 und 456:
XIV KAPITEL. Zur Frage über die Ur
- Seite 457 und 458:
- 3*9 - es koiume, da-s die das Lan
- Seite 459 und 460:
— 39' — Die Westbakáirí verle
- Seite 461 und 462:
W3 hatten -ich aus lurcht vor tlen
- Seite 463 und 464:
— 39- — Dei Háuptling Ltikti w
- Seite 465 und 466:
war, -ein unbestrittenes Verdienst.
- Seite 467 und 468:
ohr, Apfelsinen, Melonen und ziicht
- Seite 469 und 470:
401 Mutter iántá, Bak. i»e; Ohei
- Seite 471 und 472:
T"3 — keine zwei Jahrhunderte. Da
- Seite 473 und 474:
XV. KAPITEL. I. Die Zãhlkunst der
- Seite 475 und 476:
40/ indem er ihn getrennt neben \ u
- Seite 477 und 478:
— 409 - zwar wird hier, mitten in
- Seite 479 und 480:
411 — Aber damit, dass man die Z
- Seite 481 und 482:
— 413 also fa-t -o aus, ais wenn
- Seite 483 und 484:
— 4" 5 und die -ich untereinander
- Seite 485 und 486:
417 — oder der GipfcbFinger ist d
- Seite 487 und 488:
4f'J Holzkohle und Russ, die Beeren
- Seite 489 und 490:
— 42 1 — kitenart giebt, die ei
- Seite 491 und 492:
— 423 — e- einem entschiedenen
- Seite 493 und 494:
- 4^5 — -Auf jenen ausgcdchntcu I
- Seite 495 und 496:
— 427 — Untcrschcnkel, die Frau
- Seite 497 und 498:
— 429 — Das Mass 37,8 (57,5 cm
- Seite 499 und 500:
131 sei. Ab Ohrschmuck wurde — je
- Seite 501 und 502:
1 - - einige sehr schõne, mit kün
- Seite 503 und 504:
Tabakrauch anblast. Er weiss Alie-,
- Seite 505 und 506:
— 437 — Gehen wir nun aber, um
- Seite 507 und 508:
— 439 — deu schon erwahnten Gro
- Seite 509 und 510:
XVII. KAIMTKL. Zu den Bororó. I. G
- Seite 511 und 512:
— 443 — landlichen Bevõlkerung
- Seite 513 und 514:
44? — den «Barbados", fàhrt Mar
- Seite 515 und 516:
— 417 Regierung giebt die Mittel
- Seite 519 und 520:
— 449 — in Súdostrichtung von
- Seite 521 und 522:
— 45i — gegenüberlag. Die Sold
- Seite 523 und 524:
— 453 — bezeichneten die, die i
- Seite 525 und 526:
— 455 — Moguyokuri hinein; mit
- Seite 527 und 528:
- 457 — zusammen und »ordnctcn«
- Seite 529 und 530:
— 459 — und der Flcischtranspor
- Seite 531 und 532:
— áfi\ — führte er eine Schnu
- Seite 533 und 534:
— 463 — (lie Kenntnis der Prono
- Seite 535:
O tr O rr O m
- Seite 538 und 539:
— ±66 — laut lármenden nackte
- Seite 540 und 541:
— 468 — auch einmal ein wenig,
- Seite 542 und 543:
— 47° — Mi ttelgesicht. Nasenw
- Seite 544 und 545:
— 47 2 — Bastband um den Kopf g
- Seite 547 und 548:
473 — Von den Frauen der Bororó
- Seite 549 und 550:
— 47- — Sohn reklamicrte, darau
- Seite 551 und 552:
— 477 — Knochen mit Urukúól e
- Seite 553 und 554:
479 — ganze Bru-t reichenden Stü
- Seite 555:
d. Steinen. Zentrai- l»ra>itli SCH
- Seite 558 und 559:
— 482 — schalen und Bambus zu h
- Seite 560 und 561:
i% ~W^V. d./fttinen.. < I — 484
- Seite 562 und 563:
— 486 — Kapivarameissel gehõhl
- Seite 564 und 565:
488 der Stücke auf Stein schliffen
- Seite 566 und 567:
— 49° nommen hatten, meine Kõrp
- Seite 568 und 569:
— 492 — nicht einen noch vom Pa
- Seite 570 und 571:
— 494 — glaublich wãre, ich ko
- Seite 572 und 573:
496 namen Camões hiess. Die ihn an
- Seite 574 und 575:
498 müssen, wenn sie sie sehen; au
- Seite 576 und 577:
— 5°° — Die Bedeutung ist unk
- Seite 578 und 579:
— 502 — Nun die Sitten des Mãn
- Seite 580 und 581:
— 5°4 — waren intelligente, ab
- Seite 583 und 584:
— 505 — stufc der Urne — dadu
- Seite 585 und 586:
— 507 — die Sachen ringsum tanz
- Seite 587 und 588:
— 5°9 — man den geschmückten
- Seite 589 und 590:
; 11 — suchten auch sie heimlich
- Seite 591:
v. il. Steinen, Zentral-Rrusilien.
- Seite 594 und 595:
— 5H — und stiessen dabei gern
- Seite 596 und 597:
- Si6 - im Osten von dem baruparu-F
- Seite 598 und 599:
- 5i8 - da jede Person andere Angab
- Seite 600 und 601:
— 52o — waren wir plõtzlich ni
- Seite 603 und 604:
Anhang. I. Wortervcrzeichnisse der
- Seite 605 und 606:
Grossvater ápitsi. (/rossmutter ap
- Seite 607 und 608:
Knic uiripanúri. Unterschenkel uvu
- Seite 609 und 610:
Mandioka mui, uni. Mandioka gekocht
- Seite 611 und 612:
Wo der Accent nicht angegeben Zunge
- Seite 613 und 614:
Ohr nutuora, nutsóre. Ohrloch niit
- Seite 615 und 616:
53! 7. Aueto. Wo der Accent nicht a
- Seite 617 und 618:
Tabak />ii. páh. Genipapo tendiíp
- Seite 619 und 620:
Kurbi-ra--cl kam itá, kam itá. Ta
- Seite 621 und 622:
Madchen vu/lo. Háuptling uek: Medi
- Seite 623 und 624:
Nacht muku. Himmel enuknu. Wolke ku
- Seite 625 und 626:
11. Wo der Accent nicht angegeben Z
- Seite 627 und 628:
Aglltí máh. Paka upu. Gürteltier
- Seite 629 und 630:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- Seite 631 und 632:
5 5' Haben Bogen und Pfeile. sehlc.
- Seite 633 und 634:
III. Volksglaube in Cuyabá Unser H
- Seite 635 und 636:
— 55 5 so wurden dtc Steine dunke
- Seite 637 und 638:
— 557 — haben, doch bedroht die
- Seite 639 und 640:
— 559 - Wenn ein Lei( hnam wei,h
- Seite 641 und 642:
... s6x - stimmton Háusern begangc
- Seite 643 und 644:
Inhalts-Verzeichnis. Die kur.siv ge
- Seite 645 und 646:
Feuer und Holzfeucrzeug 2 19 ff. Bo
- Seite 647 und 648:
- 56; sage 381, 382. Paressísage 4
- Seite 649 und 650:
S. Manoel, Fazenda 17, 138, 142. \n
- Seite 651 und 652:
Zu berichtigen: Seite 3 Zeile 17 un
- Seite 653 und 654:
weeüiche Uúa$e vtmGreevavUfa rUdr
- Seite 655:
'>**^ m w& \&K