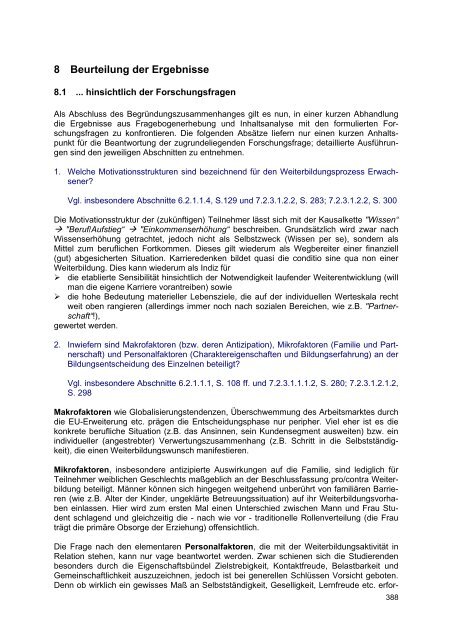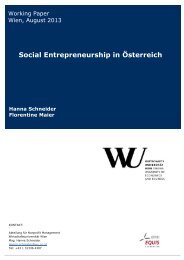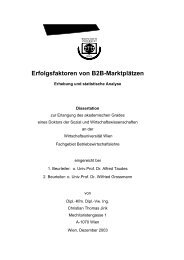- Seite 1 und 2:
Titel der Dissertation: Einflüsse
- Seite 3 und 4:
EINFLÜSSE AUF BILDUNGSEINSTELLUNG
- Seite 5 und 6:
5 FORSCHUNGSVORGEHEN BEI EMPIRISCHE
- Seite 7 und 8:
6.2.3.4 Conclusio..................
- Seite 9 und 10:
8.2 ... hinsichtlich des (modifizie
- Seite 11 und 12:
1 Einführung Durch den Dienstbegin
- Seite 13 und 14:
Noch ein Wort zur methodischen Vorg
- Seite 15 und 16:
Studie. In einem fünften und letzt
- Seite 17 und 18:
3 Begriffsklärung 3.1 Grundsätzli
- Seite 19 und 20:
Individualitätsbegriff: Im Mittelp
- Seite 21 und 22:
zueignen bzw. die bestehenden zu er
- Seite 23 und 24:
kontrastiert. Erstere ist für ihn
- Seite 25 und 26:
Angesichts dieser begrifflichen Mä
- Seite 27 und 28:
Personal- faktoren Abbildung 3: Dre
- Seite 29 und 30:
Legt man nun die Interaktion von Pe
- Seite 31 und 32:
Selbstbild nagen, wenn man mit dies
- Seite 33 und 34:
4.2 Das Konzept der kritischen Lebe
- Seite 35 und 36:
UNTERSUCHTE URSACHEN UNTERSUCHUNGS-
- Seite 37 und 38:
Ein spezifisches kritisches Ereigni
- Seite 39 und 40:
schütteltes Wohngebiet steigert di
- Seite 41 und 42:
ausfordernd oder eventuell nützlic
- Seite 43 und 44:
� Abwertung: Hier sei nur auf die
- Seite 45 und 46:
che Ursachenzuschreibung“ bzw.
- Seite 47 und 48:
die Möglichkeiten hat, sie umzuset
- Seite 49 und 50:
Ganz ähnlich dazu geht HOUSE 102 v
- Seite 51 und 52:
4.2.8 Individuelle Unterschiede Die
- Seite 53 und 54:
Zunächst wird davon ausgegangen, d
- Seite 55 und 56:
Sowohl Mikro- als auch Makroebene s
- Seite 57 und 58:
Man erlaube mir noch eine grundsät
- Seite 59 und 60:
TEIL 2 UNTERSUCHUNGSDESIGN 56
- Seite 61 und 62:
1. Forschungsinstrumentarium: Zunä
- Seite 63 und 64:
statt dessen die Entwicklung passen
- Seite 65 und 66:
Dies kann auf zweierlei Arten gesch
- Seite 67 und 68:
5.4 Forschungsdesign in der vorlieg
- Seite 69 und 70:
zu den gewünschten Ergebnissen bzw
- Seite 71 und 72:
Ausgangsbasis der Datenerhebung bil
- Seite 73 und 74:
Fragebogenergebnisse dienen somit d
- Seite 75 und 76:
jeweiligen Fragen und dem gesamten
- Seite 77 und 78:
Noch ein Wort zur technischen Unter
- Seite 79 und 80:
TEIL 3 ERGEBNISSE DER SCHRIFTLICHEN
- Seite 81 und 82:
am Ende Ihres Studiums, jedenfalls
- Seite 83 und 84:
6.1.1.2.1.2 Geschlecht Die Branche
- Seite 85 und 86:
Ein beachtlicher Wert von 87 % kenn
- Seite 87 und 88:
Aufgrund der "blockierten" Wochenen
- Seite 89 und 90:
Auch wenn insgesamt eine divergiere
- Seite 91 und 92:
geplantes Berufsziel in den nächst
- Seite 93 und 94:
offene Lehrgänge firmeninterne Leh
- Seite 95 und 96:
vertreten in der Personengruppe der
- Seite 97 und 98:
6.1.2.2.1.2 Beruf 6.1.2.2.1.2.1 Geg
- Seite 99 und 100:
Das häufig proklamierte Bild der F
- Seite 101 und 102:
sich ähnliche Schlüsse ab wie sch
- Seite 103 und 104:
6.1.3.3 Altersstruktur Interessante
- Seite 105 und 106:
6.1.3.5 Ausbildung Rund 70 Prozent
- Seite 107 und 108:
(übrigens ausschließlich männlic
- Seite 109 und 110:
Die nachstehende Übersicht grenzt
- Seite 111 und 112:
Strenggenommen dürften Teilnehmer
- Seite 113 und 114:
1. Zum einen ist unbestritten ein g
- Seite 115 und 116:
Doch zurück zum Ausgangspunkt der
- Seite 117 und 118:
hältnismäßig gering bewertet. Au
- Seite 119 und 120:
geprägten Wunsch nach einem gemein
- Seite 121 und 122:
net empfinden und daher bewusst z.B
- Seite 123 und 124:
Mittelwert Partnerschaft Kind/er El
- Seite 125 und 126:
Innovationsfreude zeitliche Flexib.
- Seite 127 und 128:
Stressresistenz psychische Belastba
- Seite 129 und 130:
den am öftesten angeführt und ent
- Seite 131 und 132:
6.2.1.1.3 Mikrofaktor 2: Berufliche
- Seite 133 und 134:
4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 ,5
- Seite 135 und 136:
Intervall- bzgl. Intervallmaß Pear
- Seite 137 und 138:
zielle Bereich kein Ausschlusskrite
- Seite 139 und 140:
einer Überforderung durch das Lern
- Seite 141 und 142:
ehrgeizig karriereorientiert lernfr
- Seite 143 und 144:
Group $WB_ZEIT Weiterbildungszeitra
- Seite 145 und 146:
Partnerschaft Familie mit Kind/ern
- Seite 147 und 148:
Eltern wurden ebenfalls recht häuf
- Seite 149 und 150:
Berufsgruppe der Finanzdienstleiste
- Seite 151 und 152:
hohen Männeranteils sind Unvereinb
- Seite 153 und 154:
eine gewisse Fluktuation in Kauf zu
- Seite 155 und 156:
6.2.2.1.2 Spannung Dass mit dem Ein
- Seite 157 und 158:
Ansonsten ist davon auszugehen, das
- Seite 159 und 160:
glücklicherweise leidet dadurch wi
- Seite 161 und 162:
Zu bedenken geben möchte ich noch,
- Seite 163 und 164:
Offene versus firmeninterne Lehrgä
- Seite 165 und 166:
kann mithilfe der gefundenen Diskri
- Seite 167 und 168:
Klassifizierungsergebnisse a Vorher
- Seite 169 und 170:
Nicht einbezogen wurde die Frage "N
- Seite 171 und 172:
Funktionen bei den Gruppen-Zentroid
- Seite 173 und 174:
Gültig Fehlend Gesamt 1,00 2,00 Ge
- Seite 175 und 176:
Hypothese 12: 1. Weiterbildung per
- Seite 177 und 178:
6.2.3 Sequenz 3 - Spannungsabbau 6.
- Seite 179 und 180:
Ziehen wir zunächst wieder das the
- Seite 181 und 182:
3. Wenn ja, welche emotionale Richt
- Seite 183 und 184:
Prozent 60 50 40 30 20 10 0 44 sehr
- Seite 185 und 186:
Cluster-Nr. des Falls * Änderung d
- Seite 187 und 188:
Prozent 100 80 60 40 20 0 70 100 se
- Seite 189 und 190:
Personenkreise handelt - bei Cluste
- Seite 191 und 192:
nicht nur aus dem Spannungszustand
- Seite 193 und 194:
einen mittleren Stimmungswert von 2
- Seite 195 und 196:
chen abfinden bzw. diese bewältige
- Seite 197 und 198:
Absolutwerte in Prozent der Auskunf
- Seite 199 und 200:
zuzuschreiben sind (diese wurden ob
- Seite 201 und 202:
cherweise weitgehend fremd sind. De
- Seite 203 und 204:
aber jedenfalls anspornendes "Wette
- Seite 205 und 206:
samen Haushalt" wieder. Von den 63
- Seite 207 und 208:
en gerufen, stellvertretend für "h
- Seite 209 und 210:
Hypothese 19: Eine Inkonsistenz des
- Seite 211 und 212:
derung bzw. Verschlechterung der St
- Seite 213 und 214:
"Weiterbildung" ist zwar als "zeitl
- Seite 215 und 216:
ihr übriges. Besonders der Verzich
- Seite 217 und 218:
zeugen nicht nur Stoff für eine Un
- Seite 219 und 220:
früheren Abschnitte verwiesen), so
- Seite 221 und 222:
Familientyp Gesamt Partnerschaft Fa
- Seite 223 und 224:
6.3.2 Clustermäßige Aufbereitung
- Seite 225 und 226:
der Nullhypothese (= es bestehen ta
- Seite 227 und 228:
Einkommensstabilität (und wenn mö
- Seite 229 und 230:
ner, nur Kind/er oder beides zuglei
- Seite 231 und 232:
FAMILIEN- TYP IM BILDUNGS- VORFELD
- Seite 233 und 234:
6.3.2.2 Lehrgangstypus In der unter
- Seite 235 und 236:
Hervorheben möchte ich jedoch die
- Seite 237 und 238:
interne Auswahlprozess bedingt ein
- Seite 239 und 240:
liche Aktivitäten verstärkt einge
- Seite 241 und 242:
LEHRGANGS- TYP WÄHREND DER WEITER-
- Seite 243 und 244:
spricht somit für einen unverhält
- Seite 245 und 246:
lienklima zu stören oder aber auch
- Seite 247 und 248:
Vermutung, nach der (positive oder
- Seite 249 und 250:
SPANNUNGS- TYP PARTNERIN SPANNUNGS-
- Seite 251 und 252:
Angesichts dieser massiven Einschr
- Seite 253 und 254:
7 Ergebnisse der qualitativen Forsc
- Seite 255 und 256:
Firmeninterner Lehrgang Code Famili
- Seite 257 und 258:
Lehrgangsname Gesamt Lehrgangsname
- Seite 259 und 260:
Lehrgangsname Gesamt Lehrgangsname
- Seite 261 und 262:
Bestimmung des Ausgangsmaterials 1.
- Seite 263 und 264:
Theoriewissen Frage- bogen Intervie
- Seite 265 und 266:
KATEGORIENSCHEMA - PARTNERINNEN Seq
- Seite 267 und 268:
Interviewleitfaden KATEGORIENSCHEMA
- Seite 269 und 270:
zur Teilnahme richten, ist an diese
- Seite 271 und 272:
2. Eine neutrale bis negative Aufna
- Seite 273 und 274:
K6 Verarbeitung des Kurserlebnisses
- Seite 275 und 276:
3. Negative Reaktionen finden sich
- Seite 277 und 278:
K'6 Verarbeitung des Kurserlebnisse
- Seite 279 und 280:
2. Als positive Reaktionen des sozi
- Seite 281 und 282:
me - erfolgte eine kognitive Anpass
- Seite 283 und 284:
"Und überhaupt die Tatsache, in de
- Seite 285 und 286:
Systematisiert man die benannten We
- Seite 287 und 288:
c. die Räumliche Nähe zum Weiterb
- Seite 289 und 290:
xes "Entscheidungsfindung". Zwecks
- Seite 291 und 292:
Kursteilnahme für sie selbst bedeu
- Seite 293 und 294:
"Von Seiten der Landesdirektion wur
- Seite 295 und 296:
ursprüngliche Hypothese vorläufig
- Seite 297 und 298:
Hypothese 6: 1. Die Weiterbildungsm
- Seite 299 und 300:
Der Stellenwert der einzelnen Leben
- Seite 301 und 302:
a. das Lernen als Zwang empfunden w
- Seite 303 und 304:
produkt", aber kein bewusst angepei
- Seite 305 und 306:
Sachverhalt bei den befragten Partn
- Seite 307 und 308:
7.2.3.1.2.3.2 Die Haltung des Kinde
- Seite 309 und 310:
. man bei der Bewältigung auf frü
- Seite 311 und 312:
versucht, Teile daraus für die jet
- Seite 313 und 314:
K42 Intrapersonale Verarbeitung Anz
- Seite 315 und 316:
c. man sich einer Herausforderung s
- Seite 317 und 318:
7.2.3.2.1.2 Kategorie 5: Berufliche
- Seite 319 und 320:
"Also wenn ich das nicht aushalte (
- Seite 321 und 322:
c. bewirkt eine intensivere Nutzung
- Seite 323 und 324:
c. zu viele und/oder zu kompliziert
- Seite 325 und 326:
immer wieder ein wenig eingespannt
- Seite 327 und 328:
1. Das Vertrauen gegenüber der Int
- Seite 329 und 330:
7.2.3.2.1.4.1 Zeitliche Verarbeitun
- Seite 331 und 332:
ewältigung des Vaters/der Mutter b
- Seite 333 und 334:
gemeinsam gelernt. Sie auf der eine
- Seite 335 und 336:
K73 Intellektuelle Verarbeitung Anz
- Seite 337 und 338:
Demgemäß sprachen auch nur zwei P
- Seite 339 und 340: � ihrem erhöhten Erkenntnisstand
- Seite 341 und 342: K8 Verarbeitung im sozialen Umfeld
- Seite 343 und 344: Pausenzeiten, Mittagessen, abendlic
- Seite 345 und 346: nach Selbstständigkeit) gelegen ka
- Seite 347 und 348: Hypothese 18: 1. Die Beziehung zum
- Seite 349 und 350: 7.2.3.2.1.8 Generierung von Hypothe
- Seite 351 und 352: Alltag wird, bleibt die Beschneidun
- Seite 353 und 354: d. wird durch die Aussicht erleicht
- Seite 355 und 356: in Prozent der jeweiligen Befragung
- Seite 357 und 358: Hausarbeiten benötigt, ist der Par
- Seite 359 und 360: f. man sich durch die Distanz wiede
- Seite 361 und 362: K64' Materielle Verarbeitung Anzahl
- Seite 363 und 364: Eine Differenz zwischen Teilnehmer-
- Seite 365 und 366: K72' Emotionale Verarbeitung Anzahl
- Seite 367 und 368: e. man sich durch die zeitliche/rä
- Seite 369 und 370: gehabt hat. (...) Dann ist er (der
- Seite 371 und 372: um nur wenige Partner von freundsch
- Seite 373 und 374: Die Hälfte der befragten Partner g
- Seite 375 und 376: 7.3 Resümee Die nachfolgenden Seit
- Seite 377 und 378: stressbeladen" zu finden sind 482 .
- Seite 379 und 380: Anzahl der Befragungspersonen 8 7 6
- Seite 381 und 382: 2. bei seiner Familie (Verkürzung
- Seite 383 und 384: 7.3.2 Interpersonale Erkenntnisse:
- Seite 385 und 386: 7.3.2.1.1 Psychische Belastung Unve
- Seite 387 und 388: zu schätzen wissen. Dem gegenüber
- Seite 389: Druck des Unternehmens INTRAPERSONA
- Seite 393 und 394: deutig zwei kritische Ereignisse id
- Seite 395 und 396: tenzspezifischen Zusammenhänge auc
- Seite 397 und 398: und nicht jene an Schulbildung maß
- Seite 399 und 400: 9 Konsequenzen für die Bildungsbet
- Seite 401 und 402: Bildungsbiographie Kulturzugehörig
- Seite 403 und 404: Vereinbarkeit mit dem Berufsleben m
- Seite 405 und 406: en Zielgruppen das Bildungsbewussts
- Seite 407 und 408: 1. Bildungsinstitution: Die Marketi
- Seite 409 und 410: schlägigen 495 beruflichen Qualifi
- Seite 411 und 412: 1. Zum einen kann nicht jedes Fachw
- Seite 413 und 414: oder, noch besser, einen Schritt vo
- Seite 415 und 416: Zumindest was den monetären Aufwan
- Seite 417 und 418: 9.3.1 Bildungsbewusstsein Grundsät
- Seite 419 und 420: Was die familiäre Belastung durch
- Seite 421 und 422: heit des Studierenden, hieß es zum
- Seite 423 und 424: Als Quintessenz zur Wirkung von Wei
- Seite 425 und 426: 11.1 Vorstudie: Fragebogen Zu Weite
- Seite 427 und 428: Gültig Fehlend Gesamt beruflich so
- Seite 429 und 430: BERUFLICHES UMFELD 1. Welche Eigens
- Seite 431 und 432: 4. Welches berufliche Ziel planen S
- Seite 433 und 434: 12. Bitte geben Sie an, ob folgende
- Seite 435 und 436: firmenextern oder - intern? Weiterb
- Seite 437 und 438: 11.4 Erläuterungen zum Fragebogen
- Seite 439 und 440: schnitt“ zu bezeichnen ist. Dies
- Seite 441 und 442:
11.5 Interviewleitfaden (Teilnehmer
- Seite 443 und 444:
6. Wie kommt/kommen Ihr/e Kind/er m
- Seite 445 und 446:
Spannungsvorfeld Partnerschaft INTE
- Seite 447 und 448:
11.7 Kommentierter Interviewleitfad
- Seite 449 und 450:
wie Weiterbildung bzw. die Konseque
- Seite 451 und 452:
einmal die Bereitschaft des Umfelde
- Seite 453 und 454:
Abbildung 49: Die drei Achsen der C
- Seite 455 und 456:
Tabelle 65: Kreuztabelle - Stimmung
- Seite 457 und 458:
13 Literaturverzeichnis Achtenhagen
- Seite 459 und 460:
Gliedner-Simon, Adelheid; Jansen, M
- Seite 461 und 462:
Peuckert, Rüdiger Familienformen i